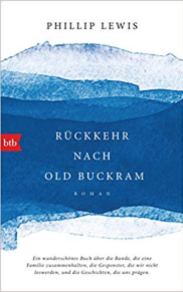Nun sitze ich hier, neben mir das gelesene Exemplar von David Granns True-Crime-Werk „Das Verbrechen“ und kämpfe im wahrsten Sinne des Wortes mit meinen Gefühlen und zwei komplett gegensätzlichen Problemen: Entweder bekomme ich überhaupt kein anständiges Wort zu „Papier“ oder es werden derer so viele, dass es den Rahmen einer vernünftigen, sachlichen Besprechung bei weitem sprengt. Dazwischen scheint es schlicht nichts geben zu können, denn die Lektüre dieses Buches wird mir sicher noch für lange, lange Zeit auf unangenehme Art und Weise in Erinnerung bleiben. Nicht aufgrund der Tatsache, dass es qualitativ irgendetwas an Granns schriftstellerischer und journalistischer Leistung auszusetzen gäbe, sondern vielmehr weil die behandelte Thematik einfach die eigene fassungslose Ungläubigkeit in einen Grenzbereich verschiebt, der emotional mitunter schwer zu verarbeiten – und noch schwerer in Worte zu fassen ist.
Wie heißt es so schön: Die Realität übertrifft jede Fiktion. Und nie ist dies wohl wahrer gesprochen worden, als im Zusammenhang mit Granns Auseinandersetzung und Aufarbeitung eines der düstersten und beschämendsten Kapitel der jüngeren US-amerikanischen Geschichte – dem hundertfachen Mord an den Osage-Indianern in den 1910er bis späten 1920er Jahren im gleichnamigen County des Bundesstaats Oklahoma. Hundertfach, das sagt und schreibt sich einfach so leicht dahin, weil es kaum greifbar und unpersönlich ist, keinerlei direkte Verbindungen zu den einzelnen Opfern herstellt. Und genau dies muss wohl auch Grann umgetrieben haben, der nämlich genau diesen Opfern mitunter bis in letzte bedrückende Detail (auch mit einer Vielzahl an Fotografien) ein Gesicht verleiht, mit unerschütterlicher Akribie das ganze Ausmaß dieses maßlosen Verbrechens ans Tageslicht zerrt, dessen Ursprünge sich in einem weiteren Verbrechen finden: der Vertreibung der Osage aus ihren eigenen Jagdgründen durch die weißen Siedler Ende des 19. Jahrhunderts.
Angetrieben von einer nie zu sättigenden Gier nach immer mehr Land und bar jeder Rücksicht für das Wohl der indigenen Bevölkerung, pferchte man viele der Indianer in kleinsten Reservaten zusammen, um sich anschließend das an Bodenschätzen und anderen Ressourcen reiche Gebiet selbst unter den Nagel zu reißen. Vor der indianischen Kultur, ihren Bräuchen und letztlich auch vor Menschenleben wurde keinerlei Halt gemacht. Schon zu dieser Zeit kostete diese brutale „Umsiedlung“ tausenden Osage das Leben, die, abgeschnitten von ihrer Jagdbeute, den Bisons, entweder an Hungertod starben oder ihrer Heimat Kansas den Rücken kehren mussten. Im Falle der Osage wurde ihnen ein neues Gebiet im Nordosten Oklahomas zugewiesen. Eine staubige, karge und steinige Landschaft, in der weder große Landwirtschaft möglich, noch sonst etwas von Wert zu vermuten war. Mit den Jahren erhielt die indigene Bevölkerung dann von Washington aus die Erlaubnis, hier auch in größeren Mengen Land aufkaufen zu dürfen, zumal sonst niemand daran irgendein Interesse zeigte. Was nun folgte entbehrt, zumindest anfangs, nicht einer gewissen Ironie.
Das auf den ersten Blick gänzlich wertlose, unfruchtbare Gebiet entpuppt sich nämlich als wahre Goldgrube, denn unterhalb des kahlen Bodens entdecken Geologen bald einige der größten Erdölvorkommen der Vereinigten Staaten. In einer Zeit, in der gerade die Industrie und insbesondere das Pferd ablösende, aufstrebende Automobil enorme Mengen dieses Rohstoffs benötigten, bedeutete diese Bodenschätze unvorstellbaren Reichtum. Und zum großen Verdruss der weißen Politiker, Geschäftsleute und Siedler waren die Osage aufgrund der geschlossene Verträge rechtmäßige Besitzer dieses Landstrichs – und damit auch deren Ressourcen. Eine erneute gewaltsame Vertreibung, wie schon in der Vergangenheit, war nun ohne weiteres nicht mehr möglich, weswegen die amerikanische Regierung diese Realität zähneknirschend akzeptieren musste.
Zumindest offiziell, denn mit der rasant steigenden Einnahmequelle der Osage durch die Bohrlizenzen, aber auch Gebühren für vergebene Pacht, erhöhte sich auch die Zahl der Neider unter den weißen Mitbürgern. Im Jahr 1923 waren die Osage aufgrund ihres Pro-Kopf-Einkommens de facto die reichsten Menschen der Welt. Auf Auktionen im County wurde zu Millionen Dollar Beträgen Land versteigert und die Presse schlachtete den steigenden Wohlstand der Ureinwohner journalistisch aus. Das Bild vom dekadenten, verschwenderischen Indianer wurde wo immer es ging kolportiert – Habsucht, Neid und erneute Gier auf Land waren die Folge.
Um diesen Entwicklungen ein Ende zu setzen und Weißen Zugriff auf das jeweilige Vermögen zu gewähren, verabschiedete die Regierung ein Gesetz, dass die Osage quasi entmündigte. Der „kindliche Indianer“ wurde per Dekret unter Aufsicht gestellt, die Verwaltung des persönlichen Vermögens an einen (natürlich weißen) Vormund übertragen, der selbst entscheiden durfte, wie viel Geld dem jeweiligen Osage zustand. In Folge dessen wurde nur noch kleine Summen an den eigentlichen Besitzer ausgezahlt, der ohnehin für fast alles einen höheren Preis zu zahlen hatte, als die Weißen. Mehr noch: Wie auf einem Markt wurden die hoch begehrten Titel als Vormund über einen oder mehrere Indianer gehandelt, die Position ausgenutzt, um sich zu bereichern. So bekam man unter anderem Provision bei Händlern, wenn das „Mündel“ dort zu besonders gepfefferten Beträgen Geld ausgab. All dies reichte aber nicht, um den Begehrlichkeiten und der Gier ein Ende zu setzen, denn immer noch lagen die „Headrights“ auf das Land bei den Osage. Und über diese und die damit verbundenen Förderlizenzen konnte erst entschieden werden, wenn der eigentliche Eigentümer verstorben war. Und hier beginnt die von David Grann erzählte, wahre Geschichte.
Mai, 1921. Der stark verweste Körper der 36-jährigen Anna Brown, eine der im Reservat nahe der Stadt Gray Horse lebenden Osage, wird in einem abgelegenen Tal gefunden. Und es soll nicht bei dieser einen Toten bleiben. Noch am gleichen Tag wird die Leiche von Charles Whitehorn nahe Pawhuska entdeckt, einem Cousin von Anna Brown. Beide sind offensichtlich durch Schusseinwirkung gestorben. Während man den Tod der Frau nach kurzen, oberflächlichen Ermittlungen als Selbstmord verbucht – als bekannte Alkoholkranke schien man mit dieser Erklärung zufrieden – kam Whitehorn eindeutig gewaltsam ums Leben. In der Gemeinde der Osage macht sich Unruhe und Angst breit, die sich bald als berechtigt erweist. Nur zwei Monate später stirbt auch Anna Browns Mutter Lizzie Q. Kyle an einer Vergiftung. Ihre beiden verbliebenen Töchter, Mollie Burkhardt und Rita Smith, bitten den selbsternannten „King of the Osage Hills“, den Indianerfreund William Hale um Unterstützung, der daraufhin Druck auf die lokalen Behörden ausübt und Privatdetektive engagiert, welche eine Verbindung der Fälle untersuchen sollen. Doch die Ermittlungen bleiben weitestgehend erfolglos – und das Sterben unter den Osage geht weiter.
Im März 1923 – viele Osage sind bereits unter mysteriösen Umständen wie Trunksucht oder Schwindsucht ums Leben gekommen – sterben auch Rita Smith, ihr Mann William „Bill“ Smith und die Hausangestellte Nettie Brookshire bei einer Explosion, die ihr ganzes Haus zerstört. Durch die steigende Zahl an Morden alarmiert, wendet sich der Osage Tribal Council nun an die US-Regierung mit der Bitte um Hilfe auf Bundesebene. Da eines der Opfer, der im Februar 1923 ermordete Henry Roan Horse, auf ausgewiesenem Indianergebiet getötet wurde, hat jetzt das noch junge Bureau of Investigation (BOI, seit 1932 Federal Bureau of Investigation = FBI) eine gesetzliche Grundlage, um selbst investigativ tätig zu werden. Was die zum Teil verdeckt ermittelnden Agenten in den kommenden Monaten aufdecken sollen, ist nichts weniger als die größte Mordserie in der Geschichte der Vereinigten Staaten …
Mit dem Mord an Anna Brown beginnend, hat sich David Grann äußerst detailliert – und wie wir später zu unserem Erschrecken feststellen müssen, auch weit investigativer als die damaligen juristischen Ermittlungen – der tieftraurigen Geschichte der Osage angenähert, wofür ihm zwar nach eigenen Worten ein gut gefülltes Archiv an Aufzeichnungen, Zeugenaussagen, Agentenberichten, Zeitungsberichten und anderen Zeitdokumenten zur Verfügung stand, diese jedoch nicht selten von der Meinung des jeweiligen Verfassers getränkt wurden. Und obwohl es anfangs noch so scheint, als wären es nur Einzelschicksale gewesen, so wird bald mit jeder weiteren Seite von „Das Verbrechen“ klar, dass das Ausmaß des Verbrechens alle Vorstellungen sprengt und fast ein jeder auf irgendeine Art und Weise in diesen Sumpf aus Gewalt, Korruption, Rassismus und letztlich auch Mord verstrickt war. Ob lokale Politiker, Privatdetektive oder das Gesetz vor Ort, der Kreis der Verschwörer durchdrang alle Gesellschaftsschichten und war in seinem Bemühen, Beweise und Indizien verschwinden zu lassen, über Jahre äußerst erfolgreich. Gerade Zeugenaussagen aus den frühen Jahre der Mordserie bleiben auffällig vage, was, wie Grann herausarbeitet, auch daran lag, dass Verräter selbst mit dem Tod rechnen mussten.
In Bezug auf den Spannungsaufbau dieser Lektüre spielt David Grann diese unsichere Datenlage rund um die ersten Morde an den Osage in die Hände, denn wie damals in der Realität, so ist es auch für den Leser schwierig, anfangs einen Verantwortlichen auszumachen, geschweige denn überhaupt den Kreis der möglichen Täter einzuengen. Dies ändert sich erst im zweiten Abschnitt des Buchs, wo sich der Autor schließlich auf die Ermittlungen durch das BOI konzentriert, welches sich zu dieser Zeit gerade in einem strukturellen und personellen Umbruch befand. William John Burns, Begründer der gleichnamigen International Detective Agency, in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts nach der Pinkerton-Detektei die zweitgrößte Agentur für Privatermittlungen, hatte lange von seinem Ruf als „amerikanischer Sherlock Holmes“ profitiert, war aber als Leiter der Behörde den modernen Anforderungen inzwischen nicht mehr gewachsen. Nach einem Untersuchungsausschuss, u.a. wegen Einschüchterung der Presse und illegaler Beschattung von US-Senatoren, wurde er 1924 zum Rücktritt gezwungen. Sein Amt wurde von einem gewissen J. Edgar Hoover übernommen, der es bis zu seinem Tode im Jahre 1972 inne haben sollte.
Hoover, der als ausgeprägter Machtmensch später selbst die Grenzen der Gesetze mehrmals überdehnen bzw. überschreiten sollte, um auf seinem Posten verbleiben zu können, war der Ansicht, dass die Methoden der Bundesagenten überholt waren und dringend geändert werden mussten. Reichten vorher noch mündliche Berichte an die Vorgesetzten aus, hielt mit dem neuen BOI-Chef nun die Bürokratie – und damit auch eine neue Sorte Ermittler Einzug. Da Hoover aber bewusst war, dass insbesondere im Fall der Osage-Morde jegliche schlechte Presse seiner jungen Organisation einen Strich durch die Rechnung machen und der Wilde Westen Oklahomas mit Schreibtischhengsten allein nicht befriedet werden konnte, musste die Mischung stimmen. Und so wurde mit Tom Smith, einem ehemaligen Texas Ranger, nochmal einer der Revolverhelden alter Schule, mit diesem Fall betraut. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte, denn obwohl sich Smith anfangs noch mit den Begleitererscheinungen moderner Polizeiarbeit schwer tat, sollte es am Ende seine Unerbittlichkeit sein, welche dem Recht zum Sieg verhalf.
Doch war tatsächlich Recht gesprochen worden? Nachdem wir erfahren, wer tatsächlich hinter einem Teil der Morde an den Osage gesteckt hat (eine schockierende Eröffnung) – und wir damit eigentlich das Ende dieser Lektüre erwarten – berichtet David Grann von seinen Begegnungen mit den Nachkommen der Opfer und fördert noch einmal Dinge zutage, die zwar letztlich rechtlich keinerlei mehr Bedeutung haben sollen, aber das ganze unfassbare Ausmaß noch genauer erahnen lassen, welches selbst den zartbesaitesten Leser in die Magengrube fahren dürfte. Wie der Autor diese Verbindungen herstellt, die Vielzahl an Hinweisen verfolgt und verknüpft, nötigt großen Respekt ab und ist vor allem für uns immer auf niederschmetternde, ja abscheuliche Art und Weise nachvollziehbar.
Fast vierzig Seiten, in denen u.a. die Quellen- und Bildnachweise aufgeführt werden, zeugen von Granns hervorragender Recherche, wobei wie bereits erwähnt besonders die vielen Fotos innerhalb des Buches ihren Teil dazu beitragen, die Brücke zwischen dem Damals und dem Jetzt zu schlagen. Das hinter jedem Mord ein Mensch und dessen Familie steht – dies war ihm offensichtlich unheimlich wichtig zu betonen. Und wenn ihnen damit letztlich auch juristisch keine Gerechtigkeit widerfährt – mit dieser Würdigung erhält der Stamm der Osage, wenn auch spät, endlich die ihm gebührende, historisch korrekte Aufmerksamkeit.
Falls es die Länge meiner Besprechung noch nicht deutlich gemacht haben sollte: David Granns „Das Verbrechen“ ist eines der qualitativ besten, informativsten, spannendsten, aber auch berührendsten True-Crime-Werke seit Truman Capotes „Kaltblütig“. Eine Abrechnung mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und dem weißen Siedler, die ihren Widerhall nicht nur in aktuellen Geschehnissen innerhalb der USA findet, sondern das in vielen Medien verklärte Bild des romantischen Wilden Westens endgültig ins Reich der Märchen und Fabeln verweist. Eine Anklage und ein Fingerzeig für kommende Generationen, so etwas nie wieder zuzulassen und Taten und Täter zu benennen, um die Wahrheit ans Licht zu zerren.
Mein persönliches Buch des Jahres 2020 und eins, das ich allen Freunden meines Blogs unbedingt zur Lektüre empfehlen möchte.
Wertung: 94 von 100 Treffern
- Autor: David Grann
- Titel: Das Verbrechen
- Originaltitel: Killers of the Flower Moon
- Übersetzer: Henning Dedekind
- Verlag: btb
- Erschienen: 11/2018
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 416 Seiten
- ISBN: 978-3730600726