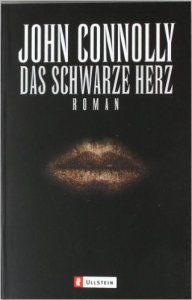Nach dem sogleich mit einem Edgar Award ausgezeichneten Debütroman „Schwarzes Echo“ ließ Autor Michael Connelly schon direkt ein Jahr später den zweiten Band aus der Reihe um den unbequemen Detective Hieronymus „Harry“ Bosch folgen und griff dabei einmal mehr auf seine reichhaltigen Erfahrungen aus der Zeit als Polizeireporter für die Los Angeles Times zurück.
Ende der 1980er konnte er sich aus erster Hand überzeugen, wie vor allem neuartige Drogen zum rapiden Verfall ganzer Gesellschaftsschichten und Stadtviertel beitrugen – und auch die Kriminalitätsrate in schwindelerregende Höhen katapultierten. Als besonders gefürchtet galt „Ice“, ein äußerst reine Form vom Methamphetaminhydrochlorid, welche, ursprünglich aus Asien stammend, vor allem in Hawaii schnell Fuß fassen und von dort schließlich auch nach Kalifornien gelangen konnte. Im vorliegenden Roman greift Connelly diese Thematik nun auf, erfindet mit „Black Ice“ eine Variante, die jedoch aus Mexiko ihren Weg in die USA findet und nutzt den Namen auch zeitgleich (und passenderweise) als Titel. Doch wie bereits schon im Vorgänger, so ist auch in „Schwarzes Eis“ Drogenhandel nur ein Element eines vielschichtigen Plots, welcher für Bosch seinen Anfang am ersten Weihnachtstag nimmt:
Bosch sitzt gerade beim Essen und beobachtet ein fernes Buschfeuer am Rand der nächtlichen Lichter von Los Angeles, als über den Polizeifunk eine Meldung eingeht und Personal zu einem Tatort in Hollywood beordert wird. Er ist irritiert, sich nicht unter den angeforderten Personen zu befinden, hat er doch eigentlich für diese Nacht Einsatzbereitschaft. Irgendjemandem scheint sehr daran gelegen zu sein, dass er bei diesem neuesten Fall außen vor bleibt. Ein zusätzlicher Anreiz für den sturköpfigen Cop, der sich nach einem kurzen Anruf bei der Dienststelle die Adresse besorgt und direkt im Anschluss auf den Weg Richtung Sunset Boulevard macht. Das Ziel ist das heruntergekommene Hideaway Hotel. Eine alte, abgewrackte Anlage voller dreckigen Absteigen – und Fundort von Calexico „Cal“ Moores Leiche, einem Drogenfahnder und Kollegen, der Bosch noch vor kurzem bei seinen Ermittlungen im Mordfall Jimmy Kapps – einem Drogenkurier, verantwortlich für den Transport der Modedroge „Black Ice“ von Hawaii nach L.A. – unterstützt hatte. Dass nun auch Moore tot ist, weckt Boschs Argwohn, zumal als Todesursache Selbstmord angegeben wird.
Bevor er sich selbst ein Bild davon machen kann, wird er jedoch von Assistant Chief Irvin Irving aufgehalten, mit dem Bosch in der Vergangenheit, erstmals im Zusammenhang mit dem „Dollmaker“-Fall (siehe Beginn von „Schwarzes Echo“), heftig aneinandergeraten ist. Irving hat die Untersuchungen offiziell an sich gerissen und gibt deutlich zu verstehen, dass die Anwesenheit des bekannten Quertreibers aus der Abteilung Hollywood unerwünscht ist. Doch Bosch lässt nicht locker, verschafft sich dennoch Zutritt und erkennt recht schnell, dass etwas an dem vermeintlichen Suizid mittels Schrotflinte nicht ganz zu passen scheint. Und überhaupt – warum ist auch die Dienstaufsicht direkt am Tatort erschienen?
Boschs Jagdtrieb ist geweckt und wird noch stärker, als immer mehr Instanzen der Behörde alles daran setzen, ihn von diesem Fall fernzuhalten. Wieso will man das Ganze so schnell zu den Akten legen? Was kann Moore entdeckt haben, dass eventuell seinen Mord rechtfertigt? Und was haben sterilisierte Fruchtfliegen damit zu tun? Bosch geht jeder möglichen Spur nach, muss aber dann doch von der Fährte ablassen, als ihn sein Vorgesetzter Lieutenant Harvey Pounds mit den liegengebliebenen Akten eines vom Dienst beurlaubten Kollegen betreut, um die bescheidene Aufklärungsquote der Abteilung etwas aufzuhübschen. Nur widerwillig nimmt sich Bosch dieser kalten Spuren an, bis ihn eine davon plötzlich zu Cal Moore und nach Mexiko, genauer gesagt in die Grenzstadt Mexicali führt. Genau gegenüber, auf amerikanischer Seite, liegt auch Calexico, die Stadt welche Moore seinen Namen gab. Ein Zufall zu viel für Moore, der langsam ahnt, dass der Großteil des „Black Ice“ inzwischen nicht mehr aus Hawaii kommt. Unter fadenscheinigen und vorgeschobenen Gründen macht er sich auf eigene Faust auf den Weg nach Mexiko – nicht ahnend, dass bereits jeder seiner Schritte von den Männern des Drogenbosses Zorillo, genannt „Der Papst“, mit Argusaugen verfolgt wird …
Was auf den ersten Blick vielleicht noch wie ein ziemlich geradliniger roten Faden aussieht, erweist sich schon bereits nach wenigen Seiten als ein abermals äußerst komplexes Geflecht vieler kleinerer Handlungsstränge, welche gerade zu Beginn höchste Aufmerksamkeit und ein gutes Namensgedächtnis seitens des Lesers voraussetzen. Es wird auch in „Schwarzes Eis“ deutlich – Michael Connelly macht wenig bis keine Zugeständnisse an eine bessere Zugänglichkeit, sondern erzählt seine Geschichte haargenau so, wie er es für richtig hält. Und das ihn dabei besonders die großen Namen des „Noir“ wie Raymond Chandler und Dashiell Hammett maßgeblich inspiriert und beeinflusst haben, will und kann er gar nicht verhehlen. Allein sein Hauptprotagonist ist – mit dem Unterschied, dass er eben (noch) nicht als Privatdetektiv arbeitet – ein Spiegelbild des klassischen Private-Eye der 30er und 40er Jahre, dem das Protokoll und Hierarchien nichts bedeuten, und der gegen jeglichen Widerstand seinen eigenen Willen durchzusetzen vermag – und damit auch immer wieder durchkommt. Ist das realistisch? Wohl kaum. Auch wenn jede Polizeistelle der Welt wohl gerne eine solch hartnäckige Spürnase wie Harry Bosch in seinen Reihen hätte – für das zerschlagene „Porzellan“ dieses mitunter brachialen „Elefanten“ würde wohl kaum ein Vorgesetzter seinen Kopf hinhalten.
Und doch speist sich gerade aus dieser Figur und Michael Connellys unnachahmlichen Gespür für die Inszenierung seiner Schauplätze die Faszination dieser inzwischen so langlebigen Reihe. Harry Bosch, nicht selten ein Arschloch wie es eben nur im Buche steht, ist genau wegen seiner aufmüpfigen Art und den unkonventionellen Methoden der perfekte Sympathieträger für den Leser, zumal er in einem Umfeld wirken darf, dass – dank Connellys eigener Erfahrungen – so lebensecht wie nur möglich herüberkommt. Von Bosch abgesehen zeichnet der Autor ein äußerst realistisches Bild des Polizeiapparats von L.A., der unter Druck der Öffentlichkeit, vorgegebener Quoten und machtgieriger Karrieristen nicht nur immer wieder äußerst unbeweglich, sondern auch für äußere Einflussnahme unheimlich anfällig ist. Zwar gehören die Zeiten der ganz großen Korruption der Justizbehörden in den frühen 90ern inzwischen lange der Vergangenheit an – die Strukturen selbst haben sich mitunter aber kaum geändert. Und so ist es auch kein Wunder, dass der unbestechliche Einzelgänger Bosch schon fast ein Dauerabonnement auf das berufliche Abstellgleis hat und oft gänzlich allein gegen alle kämpft.
In Folge dessen ist auch jeder berufliche Kontakt für Bosch vor allem eins – ein nützliches Mittel zum Zweck, das ihm letztlich dazu dient, der Gerechtigkeit, und wenn schon nicht ihr, dann wenigstens der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen. Das muss in „Schwarzes Eis“ auch Teresa Corazon erfahren, die als Stellvertretende Chefgerichtsmedizinerin vom L.A. County vom nächsten beruflichen Schritt in ihrer Karriere träumt. Bosch, mit dem sie eine Affäre hat, nutzt ihre Position rücksichtslos aus, um die Vertuschung rund um Moores Ableben an die Öffentlichkeit zu bringen und damit erst weitere Ermittlungen möglich zu machen. Connelly gelingt es dabei jedoch meisterhaft, die menschliche Seite seines Hauptprotagonisten nie außen vor zu lassen. Bosch ist bar jeder Künstlichkeit, hat nicht viel gemein mit den überzeichneten Rächergestalten, die heute den Thriller vielfach bevölkern – nein, sein Benehmen, seine ganze Persönlichkeit ist Resultat eines längeren Prozesses, der in frühen Jahren seinen Anfang genommen hat. Wie wir in „Schwarzes Eis“ erfahren, wuchs er ohne Vater auf und wurde schon in jungen Jahren aus der Obhut seiner Mutter, einer Prostituierten, geholt und in einer einem Jugendheim ähnelnden Wohnanlage, der McLaren Youth Hall, untergebracht, wo man Kinder sowohl vernachlässigt als auch systematisch misshandelt hat.
Seinen eigenen, unehelichen Vater, J. Michael Haller, lernte Harry Bosch erst in späteren Jahren an dessen Sterbebett kennen. Eine für ihn traumatische Begegnung, in der Autor Michael Connelly übrigens äußerst geschickt seine große Liebe für Hermann Hesse, insbesondere für sein Werk „Steppenwolf“ verarbeitet, dessen Hauptfigur Harry Haller sich eben aus jenen beiden Namen zusammensetzt. Für Interessierte sei erwähnt, dass an dieser Stelle auch erstmalig Michael „Mickey“ Haller, Boschs Halbbruder erwähnt wird, der zwölf Jahre später in seinem ersten eigenen (und auch verfilmten) Roman „Der Mandant“ nachhaltig Eindruck hinterlassen und anschließend dann ein fester Bestandteil des Connelly-Kanons wird. Doch bis dahin warten noch einige Bosch-Bände auf den Leser, der sich sicherlich auf jeden einzelnen freuen darf – denn auch wenn „Schwarzes Eis“ nicht ganz das hohe Niveau des großartigen Auftakts erreicht, kann das Buch doch auf vielerlei Ebenen überzeugen.
Harry Boschs zweiter Auftritt ist ein durchweg spannender Mischling aus Police-Procedural und Noir, der besonders nochmal im letzten Drittel zwischen Stierkampfarenen und verlassenen mexikanischen Herrenhäusern mit einer atmosphärischen Dichte aufwartet, die Connellys großen Vorbildern in nichts nachsteht. Wenngleich die Handlung vielleicht den ein oder anderen Haken zu viel schlägt, wandelt man unheimlich gern in den Fußspuren dieses einsamen Wolfs, der inzwischen – auch dank der erfolgreichen TV-Serienumsetzung – aus dem Olymp der Kriminalliteratur nicht mehr wegzudenken ist. Wer sich also immer noch fragt, ob ein Griff zu den frühen Bänden der Serie lohnt, dem gibt „Schwarzes Eis“ eine deutliche Antwort. Definitiv, ja.
Wertung: 86 von 100 Treffern
- Autor: Michael Connelly
- Titel: Schwarzes Eis
- Originaltitel: The Black Ice
- Übersetzer: Norbert Puszkar
- Verlag: Kampa
- Erschienen: 08.2021
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 464 Seiten
- ISBN: 978-3311155126