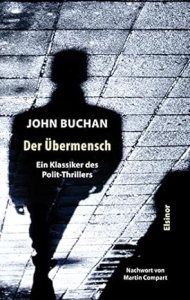Seit weit über zwanzig Jahren sammele ich inzwischen Kriminalliteratur, ergänzt durch eine auch nicht unbeträchtliche Anzahl von Büchern aus anderen Genres und zusammengefasst (oder sollte ich besser zusammengepfercht sagen?) in einer Bibliothek, welche mittlerweile aufgrund des Gewichts die Statik unseres Wohnzimmers in arge Bedrängnis bringt. Man könnte also tatsächlich passenderweise behaupten: „Mord ist aller Laster Anfang“. In meinem Fall ein Laster, das aber wenigstens keine nennenswerten gesundheitlichen Nachteile (von trockenen Augen mal abgesehen) mit sich bringt, wenngleich manch ein literarisches Mahl auf dem Weg zum „Krimi-Gourmet“ rückblickend etwas schwerer im Magen liegt – oder nach objektiven Gesichtspunkten unter äußerst leichter Kost anzusiedeln ist. Bei Ann Grangers Debüt im Spannungsgenre handelt es sich genau um solche.
Nun ist der klassische englische Landhauskrimi per se kein Sub-Genre, in dem sich Schriftsteller in der Vergangenheit in großer Zahl zu ungeahnten künstlerischen, geschweige denn spannungsreichen Höhenflügen aufgeschwungen haben. Wenig überraschend, legt das Lesepublikum doch seit Miss Marples Zeiten hier vor allem Wert auf den richtigen Schauplatz, möglichst verschrobene, skurrile Charaktere und eine dazu passende gediegene, gemütliche Atmosphäre. Die Suspense hat auch deswegen zwischen gehäkelten Tischdecken, weichen Ohrensesseln, knisternden Kaminfeuern und pfeifenden Teekesseln einen mitunter schweren Stand, was dem Erfolg des „Cozys“ allerdings nie abträglich war. Und ich bin ganz ehrlich: Ab und zu ist es tatsächlich ganz entspannend, sich nach all den depressiven, alkoholkranken Ermittlern oder geistesgestörten Serienkillern für die nächste Lektüre in einem idyllischen, abgelegenen englischen Dörfchen zu erholen. Sowohl zwischen den Buchdeckeln, als auch im wahren Leben. So nehme ich daher unseren diesjährigen Urlaub in Oxfordshire, am Rande der Cotswolds, zum Anlass, um Jahre nach dem ersten Kontakt mit diesem Buch, einen etwas kritischeren Rückblick zu wagen und eine Antwort auf die Frage zu suchen: Kann man das heute eigentlich noch lesen? Und konnte man es je?
Im Jahr 1991 hatte Ann Granger – erst als Englischlehrerin, dann im diplomatischen Dienst lange Zeit in Ländern wie Österreich, Frankreich, Deutschland, aber auch in ehemaligen Staaten wie Jugoslawien und der Tschechoslowakei, tätig – unter dem Pseudonym Ann Hulme bereits sechs Bücher veröffentlicht. Sie werden heute gerne im Bereich der „Historic Novels“ verortet, obwohl es sich bei sachlicher Betrachtung allesamt um äußerst kitschige Liebesromane handelt. Entsprechend hoch durften daher wohl die Erwartungen der Krimi-Leser gewesen sein, als im genannten Jahr mit „Mord ist aller Laster Anfang“ der erste Whodunit mit Meredith Mitchell, wie ihre Schöpferin ebenfalls Diplomatin, das Licht der Welt erblickte. Von wenigen Ausnahmen abgesehen – Martha Grimes‘ Inspektor Jury hatte inzwischen eine gewisse Popularität erreicht – war der Landhaus-Krimi zu diesem Zeitpunkt zu einer Randhauserscheinung verkommen. Keine gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Reihe, möchte man meinen. 2023, sechzehn Bände (ein 17. ist auf Deutsch für März 2024 angekündigt) und diverse andere Reihen später, muss man konstatieren: Besser hätte es für Ann Granger kaum laufen können, auch wenn der Start ein durchaus holpriger war. Und damit nun zum Inhalt:
Ungarn, Anfang der 90er Jahre. Konsulin Meredith Mitchell erhält von ihrer Cousine Eve Owens einen Brief samt Einladung für die Hochzeit von deren Tochter Sara. Meredith, Saras Patentante und von der ewigen Routine im Dienst des auswärtigen Amts inzwischen mehr als gelangweilt, nimmt die Gelegenheit wahr, dankend an und reist kurz darauf in das kleine (fiktive) Dörfchen Westerfield, nahe Bamford (ebenfalls fiktiv) in Oxfordshire. Zu ihrer Überraschung muss sie feststellen, dass sich in ihrer alten, englischen Heimat einiges verändert hat. Die ehemals allgegenwärtige Landhausidylle hat durch die Errichtung hässlicher Betonbauten sichtlich Schaden genommen, das freundliche, nachbarschaftliche Miteinander sich in Misstrauen und skeptische Zurückhaltung gewandelt. Und selbst im Hause ihrer Cousine, dem alten Wohnsitz des ehemaligen Pfarrers, scheint alles andere als Frieden zu herrschen.
Ein Unbekannter hinterlässt regelmäßig Drohungen in Form makabrer Scherze am Eingangstor, Saras künftiger Gatte fürchtet um sein feines Image und zwischen den angrenzenden Nachbarn, dem alten Bert und dem jungen Künstler Philipp Lorrimer, herrscht Streit aufgrund buddelnder Katzen im preisgekrönten Blumenbeet. Was Meredith anfangs noch als typische Verschrobenheit der Landbevölkerung interpretiert, wird recht bald bitterer Ernst. Erst wird eine der Katzen tot aufgefunden, offensichtlich vergiftet. Dann stolpert sie bei einem Besuch über die schmerzverzerrte Leiche ihres Besitzers. Schon am Vortag klagte Philipp über Bauchkrämpfe und so vermutet Meredith, dass auch hier Gift im Spiel sein muss. Alan Markby, Inspektor bei der Bamforder Polizei und auch geplanter Brautführer, wird mit den Ermittlungen in dem Fall beauftragt – und kreuzt dabei, zu seiner wachsenden Verstimmung, immer wieder die Wege von Meredith, die sich als Hobbydetektivin gebärt und ihrerseits Nachforschungen anstellt. Zeichnet wirklich der alte Bert für die Vergiftung verantwortlich? Und ist Gift überhaupt die einzige Todesursache? Als sie der Wahrheit immer näher kommt, ist es endgültig vorbei mit der Beschaulichkeit im ruhigen Westerfield …
Als ich Mitte 2000er, auch dank des damals noch lebendigen Forums auf der Website Krimi-Couch (nun ein Schatten ihrer selbst), die Perlen der DuMont-Kriminalbibliothek nach und nach für mich entdecken durfte, richtete sich der Blick auf weitere Literatur aus dem Bereich des Whodunit. Seit dem Golden Age hatte sich aber der Spannungsroman, auch dank auf Realismus pochenden Schriftstellern wie Dashiell Hammett oder Raymond Chandler, weiterentwickelt. Morde unter Gentleman in alten Herrenhäusern und in verschlossen Räumen waren lange genau so außer Mode, wie Hobbydetektive mit Anzug und Zigarre. Morde wurden nun immer blutiger und wissenschaftlicher seziert. Und der Leser sollte weniger zum Miträtseln angeregt, als vielmehr durch immer plastischere Schilderungen geschockt und gegruselt werden. Dennoch scheint es gerade zur Jahrhundertwende eine kleine Renaissance des klassischen Mystery-Novels gegeben zu haben. Anfangs noch in Form von Persiflagen oder Hommagen, wie z.B. in Gilbert Adairs „Mord auf ffolkes Manor“, eroberte sich der Whodunit wieder einen Platz in den Buchhandlungen zurück. Und so musste ich letztlich unvermeidlich auch über die Ann Granger Titel – oder besser gesagt über deren sehr einprägsame Cover stolpern.
Konzentriert man sich allein auf die Aufmachung des Buches, so kann man durchaus feststellen: Das Buch hält genau das, was es verspricht. Wer sich über das pittoreske Dorfidyll hinaus aber große Hoffnungen auf einen winkelten, komplexen Plot oder einen Meisterdetektiv wie Miss Marple macht, der kann dieser (zumindest für den ersten Band der Reihe) direkt wieder begraben. Ann Granger vermag es nicht zu kaschieren, dass sie zum allerersten Mal einen Fuß in das Krimi-Genre setzt, denn der Plot knarzt allerorten und ist ähnlich wie schwerfällig, wie die alten Holztüren der Cottages in Westerfield. Zwar gelingt es ihr durchaus, den Schauplatz optisch einen St. Mary Mead von Agatha Christie anzugleichen, bevölkert ihn aber mit wandelnden Klischees, die sich dick eingepackt in Stereotypen kaum bewegen können und daher Lebendigkeit vermissen lassen. Fast scheint es so, als hätte sich Granger hier Punkt für Punkt durch die To-Do-Liste „Was gehört alles in einen Whodunit“ gearbeitet und darüber hinaus vergessen, dass alles auch logisch – und vor allem für den Leser überraschend zu verknüpfen.
Ironischerweise wirken sich diese Schwächen aber weit weniger auf das Lesevergnügen aus, als die Hauptprotagonistin, Meredith Mitchell. Bar jeglichen Sinns für Humor, motzt, zickt, meckert und trampelt die Diplomatin (!) durch die Szenerie, durchgängig im Angriffsmodus auf alles, was auch nur im Begriff ist, Widerworte zu geben oder ihrem Treiben Einhalt zu gebieten. Natürlich hätte es auch ein kleiner Belgier mit Eierkopf oder die alte wirre Oma nie über das Sperrband eines Tatorts geschafft. Es wirkt rückblickend aber dennoch logischer, als die Anwesenheit dieser personifizierten weiblichen Abrissbirne, die so ziemlich alles tut, um den Leser gegen sich aufzubringen. Alan Markby, im weiteren Verlauf der Reihe wichtige zweite Hauptfigur, hat dagegen kaum Raum, um sich entfalten zu können und ist sich daher in erster Linie unseres Mitleids sicher. Eine Mischung also, an der „Mord ist aller Laster Anfang“ eigentlich noch vor Auffinden der ersten Leiche hätte krepieren müssen.
Umso überraschender, dass mich trotzdem irgendetwas an dieser Lektüre um den Finger wickeln konnte, was mit Worten nur schwer zu greifen ist. Meredith nervt, ja. Die Kulisse könnte kaum künstlicher sein, sicher. Aber obwohl diese Mängel so offensichtlich sind, lullt uns Ann Granger mit dieser Tee-und-Keks-vorm-Kamin-Atmosphäre dermaßen geschickt ein, dass man unwillkürlich tiefer in den Sessel sinkt und darüber hinaus die Zeit (und viele der offensichtlichen Kritikpunkte) einfach vergisst. Es ist diese Rutherfordsche Gemütlichkeit, die den Leser in eine warme Decke packt, welche zum Markenzeichen der Reihe werden wird, in „Mord ist aller Laster Anfang“ aber allein noch nicht ausreicht, um eine wirkliche Empfehlung aussprechen zu können. Granger deutet hier zwar ein gewisses Potenzial an, ist aber sichtlich noch auf der Suche nach dem eigenen Stil, mit dem dann auch eine dringend benötigte Leichtigkeit einhergehen könnte.
So ist Meredith Mitchells erster Fall dann nur für diejenigen von Interesse, welche literarische Entschleunigung vom chaotischen Alltag in Form eines Landhaus-Krimis suchen oder Serien immer unbedingt von Anfang an verfolgen möchten. Allen anderen empfehle ich, etwas später in diese sich im weiteren Verlauf tatsächlich stetig steigernde Reihe einzusteigen.
Wertung: 71 von 100 Treffern
- Autor: Ann Granger
- Titel: Mord ist aller Laster Anfang
- Originaltitel: Say It with Poison
- Übersetzer: Edith Walter
- Verlag: Bastei Lübbe Verlag
- Erschienen: 10.2022
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 304 Seiten
- ISBN: 978-3404189113