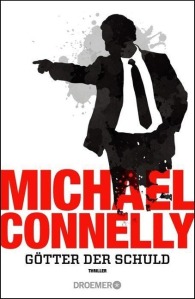England, Mitte der 20er Jahre. Agatha Christie hat sich zwar inzwischen bereits einen Namen gemacht, wird aber immer noch mit großen Schriftstellern wie Sir Arthur Conan Doyle und Gilbert Keith Chesterton verglichen und ihr Werk entsprechend auch an deren gemessen. So mutet es fast als ob sie genau jenen nacheifern will, als sie mit „Poirot rechnet ab“ 1924 eine Kurzgeschichtensammlung vorlegt, in welcher der belgische Detektiv in elf kniffligen Fällen seinen detektivischen Spürsinn – und sein Partner Captain Hastings mal wieder eine Menge Geduld beweisen muss.
In Wirklichkeit ging dieser Impuls damals jedoch von Christies Lektor Bruce Ingram aus, der, beeindruckt von ihrem Debüt „Das fehlende Glied in der Kette“, sie dazu animierte, es ihren Vorbildern doch ebenfalls in knapperer Form gleichzutun. Eine Anregung, der sie der Überlieferung zu Folge nur äußerst widerwillig nachkam, zumal die ganze Vorbereitung des Buches unter äußerst schlechten Vorzeichen stattfand, entzündete sich doch an diesem Titel ein eskalierender Zwist zwischen der Autorin und ihrem Verleger John Lane. Mit ihm hatte sie erst ein paar Jahre zuvor, zu Beginn ihrer Karriere, einen Vertrag über sechs Bücher abgeschlossen, den sie nun nicht nur als ausbeuterisch erkannte, sondern der ihr im Fall von „Poirot rechnet ab“ auch die Auswahl der Geschichten für die Sammlung und deren Veröffentlichungsdatum diktierte. Allen hinsichtlich des finalen Titels konnte sich Christie durchsetzen und zudem festhalten, dass das Buch offiziell zu ihrem Sechs-Bücher-Vertrag gezählt wurde. Da die Geschichten zuvor bereits im Sketch-Magazine erschienen waren, kam es zu einer Verhandlung vor Gericht, welche die Autorin letztlich für sich entscheiden konnte. Das Tischtuch war jedoch endgültig zerschnitten, was man heute noch daran erkennen kann, dass auch jegliche Widmung in der Kurzgeschichtensammlung fehlt.
Umso erstaunlicher, dass sich die Stories – welche in verschiedenen Jahren von Poirots Karriere spielen, aber bis auf ein paar Ausnahmen (u.a. überquert er in „Der raffinierte Aktendiebstahl“ den Atlantik) vorwiegend im Umkreis von London angesiedelt sind – auch heute immer noch äußerst kurzweilig lesen und als Rätselspaß für zwischendurch einen durchaus guten Job machen. Poirot und sein Partner Captain Hastings, mittlerweile fester Begriff im Gesellschaftsleben der Hauptstadt, werden immer dann zu Rate gezogen, wenn ein Problem zu schwierig oder ein Fall zu mysteriös ist. Geschildert werden ihre gemeinsamen Ermittlungen dabei (in bester Watson-Manier) aus der Sicht des ehemaligen Soldaten, der sich nicht selten von seinem belgischen Freund unterschätzt fühlt und sich stets aufs Neue angesichts dessen offensichtlicher Eitelkeit die Haare raufen muss. Neben seinen kriminalistischen Fähigkeiten, so hat Poirot auch die Selbstverliebtheit auf ein ganz neues Niveau gehoben, was es für seine Mitmenschen zu ertragen gilt. Und das diesmal in den folgenden 11 Fällen:
- Die Augen der Gottheit
- Die Tragödie von Marsdon Manor
- Die mysteriöse Wohnung
- Das Mysterium von Hunter’s Lodge
- Der raffinierte Aktiendiebstahl
- Das Abenteuer des ägyptischen Grabes
- Der Juwelenraub im Grand Hotel
- Der entführte Premierminister
- Das Verschwinden Mister Davenheims
- Das Abenteuer des italienischen Edelmannes
- Das fehlende Testament
Größere Ausfälle gibt es unter den einzelnen Geschichten keine. Ganz im Gegenteil: Ein paar gehören sogar zu den besten Kurzabenteuern des belgischen Detektivs, was interessanterweise dann auch eins zu eins für ihre ITV-Verfilmungen mit David Suchet in der Hauptrolle gilt. Hier ist zum Beispiel schon der Auftakt, „Die Augen der Gottheit“, zu nennen, in dem der Diebstahl eines legendären chinesischen Diamanten angekündigt und Poirot als Ratgeber hinzugezogen wird. Was folgt ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit einer gut aufgelegten Spürnase, das natürlich gleichzeitig auch als Verbeugung vor dem großen Wilkie Collins zu verstehen, an dessen „Monddiamant“ sich Christie ganz unverblümt orientiert. Der zweite Streich folgt sogleich mit der Geschichte „Die Tragödie von Marson Manor“, welche, von einer gespenstischen und unbehaglichen Atmosphäre durchdrungen, eine Vogelflinte ins Zentrum von Poirots Interesse rückt. In „Das Mysterium von Hunter’s Lodge“ übernimmt stattdessen Hastings die Zügel, während der Detektiv selbst von einer Grippe ans Bett gefesselt ist. Der Fall rund um den Sohn von Baron Windsor (interessante Namenswahl seitens Agatha Christie) führt den etwas tolpatschigen Ex-Soldaten gemeinsam mit dem allgegenwärtigen Inspektor Japp in eine einsame Jagdhütte in den Mooren von Derbyshire – und den Leser damit in ein unheimliches, bedrohliches Ambiente.
Mit „Das Abenteuer des ägyptischen Grabes“ offenbart Agatha Christie erstmals ihr starkes Interesse an die Archäologie – einem Themenfeld, dem auch ihr späterer zweiter Ehemann Max Mallowan entstammt und das sich im Laufe der Zeit, neben der Schriftstellerei, zu ihrer anderen große Leidenschaft entwickelt. Poirot und Hastings reisen hier zu einer Ausgrabungsstätte nahe der Pyramiden von Gizeh, wo vermeintlich die Kräfte des Bösen am Werk sind und die sonst so sachliche Herangehensweise des Detektivs auf eine schwere Probe gestellt wird. Weitere Highlights sind „Der entführte Premierminister“ (Gegen Ende des Ersten Weltkrieges werden Poirot und Hastings in eine rasante Spionagegeschichte hineingezogen) sowie „Das Verschwinden Mister Davenheims“ (Poirot löst einen Fall, ohne sich vom Stuhl zu erheben) und „Das Abenteuer des italienischen Edelmannes“ (Ein Mord in einem geschlossenen Raum will aufgeklärt werden).
Wie schon in Christies Romanen, so stellt die Autorin auch hier die Kombinations- und Beobachtungsgabe des Lesers immer wieder vor einige Herausforderungen. Eifrig habe ich mich in die Fälle gestürzt, versucht mit Poirots Augen zu sehen und die kleinen grauen Zellen zu aktivieren, um Licht in die oft unlösbar wirkenden Fälle zu bringen. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich bei einem Großteil der Geschichten ähnlich ratlos war wie der gute Hastings, was wiederum für ihn oder gegen mich spricht. In jedem Fall ein Beleg dafür, wie gut Christie ihre Plots auch auf kleinstem Raum konstruiert bzw. konzipiert hat, denn Hinweise, welche der Schlüssel zur Lösung gewesen wären, findet (wer sich die Mühe macht) man im Nachhinein, wenn auch gut versteckt, immer. Dabei kommt natürlich, ganz in der Tradition des Whodunit, keine Spannung im wörtlichen Sinne auf, was der Kenner des Genres jedoch weiß und ihn wenig überraschen dürfte.
„Poirot rechnet ab“ ist am Ende ein wirklich guter, eleganter und auch intelligenter Sammelband, der mit seinem vorzüglichen Humor und den schrägen Figuren bestens unterhält – und gleichzeitig das Verbrechen als Form der Unterhaltung gesellschafts- und salonfähig macht. Ein Leckerbissen für alle Fans der Queen of Crime und von klassisch-britischen Detektivgeschichten.
Wertung: 83 von 100 Treffern
- Autor: Agatha Christie
- Titel: Poirot rechnet ab
- Originaltitel: Poirot investigates
- Übersetzer: Ralph von Stedman
- Verlag: Fischer
- Erschienen: 09/2004
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 208 Seiten
- ISBN: 978-3596167647
Nachtrag: In der ursprünglichen Fassung dieser Rezension habe ich behauptet, die Serie mit David Suchet wäre eine BBC-Produktion. Das ist natürlich Unsinn, zeichnet hierfür doch ITV verantwortlich. Vielen Dank an Joachim Feldmann für den Hinweis zur Korrektur.