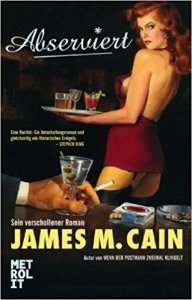„Ich suche Elmore Leonard.“
„Elmore wer?“
„Na, Elmore Leonard. „Schnappt Shorty“, „Out of Sight“ und „Jackie Brown“ basieren auf seinen Büchern.“ „Ach, der.“
Zugegebenermaßen ein fiktiver Dialog, der jedoch möglicherweise mal im Umfeld einer Buchhandlung so stattgefunden haben könnte, denn, wie Horst Eckert in Bezug auf Elmore Leonard äußerst treffend in dessen Kurzbiographie auf der Krimi-Couch bemerkt:
„Seine Bücher stehen im Schatten ihrer Verfilmungen. Sie gelten bei uns als Insidertipps, und das in einem Land, dessen Krimileser doch traditionell nach Amerika schielen.“
Bei eben dieser Klientel wagte der Eichborn Verlag vor mehr als zehn Jahren mit Leonards (bisher) vorletzten Roman „Road Dogs“ nochmals einen neuen Versuch. Und „wagen“ ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, da es dieses Werk, trotz einer sehr gelungenen Übersetzung durch die Damen Conny Lösch und Kirsten Riesselmann, inmitten des tristen Mainstream-Wühltischs aus depressiven Forensikern, romantischen FBI-Ermittlern und schlachtenden Serienkillern auf dem deutschen Büchermarkt wieder schwer haben wird.
Kurz zur Geschichte: Jack Foley (George Clooney spielte seine Rolle in Steven Soderberghs Verfilmung des Vorgängerromans „Zuckerschnute / Out of Sight“) ist ein cooler Bankräuber. Und ein schwer zu bekehrender dazu. Das FBI vermutet, dass an die zweihundert, stets unbewaffnete Überfälle auf sein Konto gehen. Foley selbst hat ein paar weniger gezählt. Im Knast, in den er dank der (oder des?) zielsicheren US-Marshall Karen Sisco wieder gewandert ist, zollen ihm selbst die Schwerverbrecher Respekt. Man ist ein wenig stolz auf die Bekanntschaft mit einen Mann, der mehr Banken geknackt als John Dillinger oder William „Willie“ Sutton. Von dieser Prominenz profitiert auch der Exil-Kubaner Cundo Rey, der hinter Gittern zu Foleys bestem Kumpel wird. Sie passen aufeinander auf, halten sich den Rücken frei – werden „Road Dogs“. Cundo, der nicht mehr lange einsitzen muss, will Foley zu einer drastischen Strafminderung verhelfen. Da er selbst, dank der geschickten Arbeit seines Verwalters „Monk“, mit Immobilien ein Vermögen gescheffelt hat, bezahlt er eine erstklassige Anwältin, welche Foleys dreißigjährige Haftstrafe kurzerhand auf ebenso viele Monate runterkürzt, so dass dieser sogar noch vor Cundo ungesiebte Luft atmen kann.
So schön die Freiheit nun ist, Foley hat kein gutes Gefühl. Er schuldet Cundo einen ganzen Batzen Geld und fühlt sich diesem verpflichtet. Wie soll er die Kohle auftreiben? Wieder eine Bank ausrauben? Was für ihn früher ein Leichtes war, wird nun durch die Tatsache erschwert, dass der übereifrige FBI-Agent Lou Adams seine ganze berufliche Karriere aufs Spiel setzt, um Foley beim nächsten Mal auf frischer Tat zu ertappen. Der Mann, der sich schon als neuer Melvin Purvis sieht, plant sogar ein Buch über die Verhaftung des „netten Bankräubers“. Dieser taucht erst einmal in einer von Cundos Villen in Venice Beach unter, wo dessen attraktive Frau Dawn Navarro bereits auf ihn wartet. Sie hat die letzten Jahre für ihren Mann vorgeblich wie eine Heilige gelebt und steigt jetzt sogleich mit Foley in die Kiste. Auf die Chance, ihren Gatten um sein Geld zu erleichtern, hat sie lange hingearbeitet. Und wer könnte ihr da besser helfen als ein trickreicher Bankräuber? Foley, der nicht weiß, wem er trauen kann, ist gefangen zwischen den weiblichen Reizen Dawns und seiner Schuld bei Cundo. Während jeder den anderen übers Ohr zu hauen versucht und nichts so ist wie es scheint, muss Foley einen Weg finden, um Heil aus dem Ganzen herauszukommen …
„Ein klassischer Leonard: lakonisch, schnell, voll herrlicher Dialoge und überraschend bis zur letzten Seite. Große Unterhaltung mit Soul.“
Wieso sich als Rezensent große Mühe machen, wenn die Werbung des Eichborn-Verlags im Klappentext bereits ein treffendes Urteil abgibt? Elmore Leonard, der im Jahr 2013 gestorben und in seiner langen, nicht selten schwierigen Karriere als Autor von Westernheften und später Gaunerkomödien unter anderem mit drei Edgar Allan Poe Awards und einem Grand Master Award ausgezeichnet worden ist, bleibt sich auch mit „Road Dogs“ treu. Und auch wenn er seinen amerikanischen Kultstatus nie gänzlich auf Europa übertragen konnte, so schimmern doch zwischen den Zeilen immer die Gründe hervor, warum er ihn überhaupt erhalten hat.
Fakt ist: Ob es auf dem Cover draufstehen würde oder nicht, einen Leonard erkennt man sofort. Hier sitzt jedes Wort am richtigen Platz, sind die Dialoge geschliffen wie die schärfsten Messer. Da ist kein Satz zu viel, ist jede Zeile im Einklang mit dem Rhythmus. Egal, welche Wege der Autor in seinem Plot einschlägt, stets beherrscht sein trockener Humor die Szenerie, überzeugen die Bilder mit einer Lässigkeit und Coolness, welche man woanders vergebens sucht. Während andere Schriftsteller die Gänge durchjagen, das Gaspedal ihrer Story auf Vollgas durchtreten, bedeutet die Lektüre eines Leonards chilliges und geradliniges Cruisen. Der rote Faden ist hier so gerade wie ein amerikanischer Highway, sein Sound einmalig. Diesem gerecht zu werden, ihn richtig zu treffen, bedeutet für die Übersetzer Schwerstarbeit. Leonards unverwechselbaren Klang, seine Vorliebe für knappe, lakonische Dialoggewitter kann man nur mühsam und unzulänglich ins Deutsche übertragen. Vielleicht ein Grund, warum der amerikanische Autor hierzulande bisher nur so wenige Leser gefunden hat.
An den Plots selbst kann es jedenfalls nicht liegen, denn wie Leonard in ein auf den ersten Blick so triviales Handlungsgerüst derart viel Tiefgang hineinpackt, dass muss zwangsläufig beeindrucken. Mal leicht und spritzig, mal boshaft und brutal. Der Autor balanciert stets mit unbekümmerter Leichtigkeit auf dem dünnen Seil, zieht dessen Fäden erst gegen Ende zusammen, das zwar nicht mit den Twists und Turns heutiger Thriller aufwartet, aber dennoch immer die ein oder andere Überraschung bereithält. Bis dahin lebt der Krimi vom Zusammenspiel der Figuren, in diesem Fall von Foley, Cundo und Dawn, deren verstrickte Dreiecksbeziehung an eine Pokerpartie gemahnt, bei der die Blätter auf der Hand auch für den Beobachter allesamt verdeckt bleiben. Es wird getäuscht, geblufft, gereizt und letztlich auch verzockt, während der Leser zwischen den vielen Andeutungen und Unklarheiten die wahren Absichten zu entdecken versucht. Es bleibt bei einem Versuch, denn Leonard schreibt mit traumwandlerischer Sicherheit und entpuppt sich in den eigenen eng gesteckten Grenzen als Meister seines Fachs.
Vom Moralisieren hält Leonard auch in „Road Dogs“ nichts. Die tragenden Säulen der Geschichte stammen zwar aus unterschiedlichen Milieus, sind jedoch, jeder auf ihre Weise, kriminell. Selbst FBI-Agent Lou Adams vermag die Rolle des „Guten“ nicht auszufüllen, da er in seiner verbissenen Jagd auf Foley das normale Maß der Gesetzesvollstreckung bereits weit überschritten hat. Genau diese genaue Schilderung, diese präzise gezeichneten Individuen (eine Femme Fatale darf natürlich auch nicht fehlen), machen Leonards Bücher aber auch immer so besonders. Er gewährt einen detaillierten Einblick in einen Grenzbereich der Gesellschaft, wo Kleinkriminelle, Spitzel, Starlets oder Prostituierte ihr Leben fristen und der (zumindest in den meisten Fällen) weit weg von den alltäglichen Erfahrungen des Lesers liegt.
Elmore Leonards „Road Dogs“ ist dynamischer und bitterer Pulp mit einem Schuss Erotik und sommerlichem Kalifornien-Flair. Eine klassisch-elegante Geschichte, die schnurrt wie ein Kätzchen. Und die mag ja bekanntlich auch nicht jeder.
Wertung: 84 von 100 Treffern
- Autor: Elmore Leonard
- Titel: Road Dogs
- Originaltitel: Road Dogs
- Übersetzer: Conny Lösch, Kirsten Riesselmann
- Verlag: Eichborn
- Erschienen: 01.2011
- Einband: Hardcover
- Seiten: 304 Seiten
- ISBN: 978-3821861197