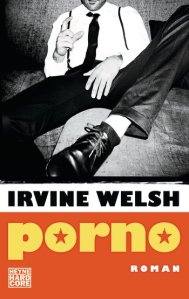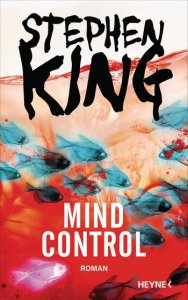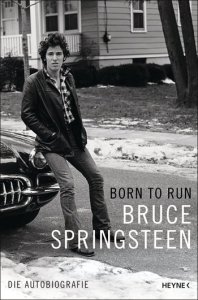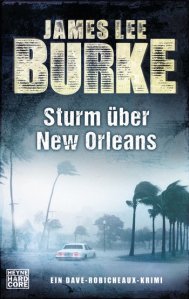Maine, USA, in den späten 70er Jahren. Im Hause King herrscht Aufbruchstimmung. Nachdem er sich jahrelang mit diversen Nebenjobs nur notdürftig über Wasser halten konnte, bedeutet die Veröffentlichung von „Carrie“ für ihn den persönlichen Wendepunkt. Stephen King, der sich schon seit jeher immer in erster Linie als Schriftsteller verstanden hat, scheint nun endlich am Ziel seiner lang gehegten Träume angekommen.
Nicht nur, dass er finanziell von seinem Erstlingswerk profitiert (auch „Shining“ entwickelt sich, diesmal sogar gleich im Hardcover, als Riesenerfolg), es ermöglicht ihm im selben Zug, lang gehegte Ideen umsetzen, Manuskripte und Notizen weiter ausarbeiten zu können. Eine davon ist „The Stand – Das letzte Gefecht“, welches er später als sein persönliches Vietnam bezeichnen sollte, denn die Geschichte um einen todbringenden Virus schien auch den jungen Autor unheilbar zu infizieren, der sich stellenweise um Kopf und Kragen schrieb und schier kein Ende finden konnte. Eine Situation, welche sein Verlag Doubleday, der auf den Vertrag mit der Vorgabe eines Buchs pro Jahr pochte, zunehmend mit Sorgen betrachtete. King, der in naher Zukunft nicht mit der Fertigstellung seines Epos (bis heute ist es sein Roman mit den meisten Seiten) rechnete, schlug als „Entschädigung“ eine Sammlung seiner Kurzgeschichten vor. Einige davon waren bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Magazinen (u.a. im „Penthouse“ und dem „Cavalier“) erschienen, andere hatte er gerade erst geschrieben. Ein Vorwort (das erste, von vielen die folgen sollten) sollte das Paket abrunden.
Der Vorschlag Kings stieß seitens des Verlags anfangs auf wenig Gegenliebe. Schon damals waren Kurzgeschichtensammlungen weit schwerer an den Mann zu bringen als Romane und so ganz schien mich man sich der Strahlkraft des Autors zudem noch nicht sicher. Am Ende willigte Doubleday doch ein, druckte eine kleine Auflage von ein bisschen mehr als 10.000 Exemplaren – und musste zügig nachsteuern, denn die Nachfrage war riesengroß. 1979 wurde die Sammlung in der Kategorie „Collection“ gar für den „World Fantasy Award“ nominiert. Das aus der Not geborene Experiment erwies sich letztlich als großer Erfolg – und King sollte dem Format der Kurzgeschichte auch in Zukunft (zum Glück für uns Leser) treu bleiben. Folgende Stories sind in „Nachtschicht“ enthalten:
-
Briefe aus Jerusalem
-
Spätschicht
-
Nächtliche Brandung
-
Ich bin das Tor
-
Der Wäschemangler
-
Das Schreckgespenst
-
Graue Materie
-
Schlachtfeld
-
Manchmal kommen sie wieder
-
Erdbeerfrühling
-
Der Mauervorsprung
-
Der Rasenmähermann
-
Quitters, Inc.
-
Ich weiß, was du brauchst
-
Kinder des Mais
-
Die letzte Sprosse
-
Der Mann, der Blumen liebte
-
Einen auf den Weg
-
Die Frau im Zimmer
In Angesicht des inzwischen so umfangreichen Werks von Stephen King wird sich jetzt vielleicht manch einer fragen, warum man sich unbedingt seine Kurzgeschichten aus den 70er Jahren zu Gemüte führen sollte. Eine Frage, die sich kurz und bündig beantworten lässt: Weil „Nachtschicht“ tatsächlich ein paar seiner besten Erzählungen beinhaltet, welche zudem noch vielfältigste Aspekte des Horros, aber auch anderer Genres bedienen. Den Anfang macht dabei „Briefe aus Jerusalem“, zu der ich an dieser Stelle nicht mehr viel schreiben möchte (meine Meinung lässt sich in der Rezension zur „Brennen muss Salem“-Ausgabe nachlesen). Dass es sich hierbei um eine Reminiszenz an die Werke Lovecrafts (und um eine Vorgeschichte von „Brennen muss Salem“) handelt, dürfte aber sowohl aufgrund des Schauplatzes und des zeitlichen Kontexts sowie der Erzählform (In Briefen wird von den Geschehnissen berichtet) klar erkennbar sein. Und auch das „De Vermis Mysteriis“, um das es in der Geschichte geht, wurde in der Vergangenheit bereits öfters von Lovecraft und anderen Autoren verwendet.
Einen starken, stilistischen Kontrast dazu stellt dann „Spätschicht“ dar, welche nicht nur zu den frühesten Werken Stephen Kings zählt, sondern sich fast als Archetyp des 70er Jahre Horrors präsentiert, wenn, ja wenn der Autor nicht auch unterschwellig die sozialen Missstände, insbesondere in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, kritisieren würde. Die Aufräumarbeiten in einer alten Spinnerei müssen unter denkbar unwürdigsten Umständen stattfinden, was den autoritären Vorarbeiter aber nicht davon abhält, seine Untergebenen anzutreiben. „Spätschicht“ (1990 als „Nachtschicht“ mit u.a. Brad Dourif verfilmt) überzeugt vor allem durch seine unheimliche und klaustrophobische Atmosphäre, hinterlässt aber sonst keinen größeren Eindruck. Das gilt auch für „Nächtliche Brandung“, sozusagen ein Teaser zum kommenden „The Stand“, in der wir eine Gruppe von Jugendlichen zum Strand begleiten, wo einer ihrer Freunde als Menschenopfer verbrannt wird, um vermeintlich „Böse Geister“ zu besänftigen und deren Zorn von den Verbliebenen abzuwenden. Ein, wie wir wissen, nutzloses Unterfangen, denn gegen Captain Trips, das Supervirus A6, gibt es keine Heilung. So ist dann auch diese Geschichte wenig überraschend und bleibt entsprechend kurz im Gedächtnis.
Anders sieht das dann schon bei „Ich bin das Tor“ aus, in dem Stephen King Science-Fiction mit Horror verknüpft, wenn ein Astronaut, Rückkehrer einer Mission zur Venus, als Transportmittel für einen aggressiven Symbionten fungiert, der nach und nach die Kontrolle übernimmt. Eine gruselige, kompromisslose Geschichte, die etwaigen Hoffnungen bezüglich des Protagonisten ganz am Ende nochmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Wer meint, damit schon den Höhepunkt in Punkto fehlendem Realismus gelesen zu haben, wird sich mit „Der Wäschemangler“ eines Besseren belehrt sehen, in der die titelgebende Maschine zum menschenfressenden Monster mutiert, dem sich nur zwei Menschen mutig mittels christlicher Teufelsaustreibung entgegenstellen. Wer in der Lage ist, sein Gehirn hier mal ein paar Minuten Ruhe zu gönnen, wird durchaus Spaß an dieser vollkommen absurden Geschichte haben, zu der Stephen King wohl seine eigene Vergangenheit (er arbeitete selbst eine Zeitlang als Bügler in einer Industriewäscherei in Bangor) maßgeblich inspiriert hat. Und für die King-Fans noch ein kleiner Hinweis bzw. eine weitere Verbindung: Auch „Carries“ Mutter und Barton Dawes („Sprengstoff“) haben in der Blue Ribbon Wäscherei ihre Finanzen aufgebessert.
Es folgen mit „Das Schreckgespenst“, „Graue Materie“ und „Schlachtfeld“ drei weitere äußerst kurzweilige und solide Geschichten, wobei erstere in gewisser Weise auch eine Blaupause für „Shining“ darstellen dürfte, dient doch auch hier der Vater als Parabolspiegel für das nicht greifbare Böse (in dessen Beschreibung fühlte ich mich an die Beschreibungen zu Beginn von „Cujo“ erinnert), wohingegen in „Graue Materie“ die Alkoholsucht zentrales Element der Erzählung ist und maßgeblichen Anteil an einer verhängnisvollen Verwandlung hat. Inwieweit Stephen King an dieser Stelle seine eigenen Dämonen beschrieben hat, kann nur erahnt werden. Es wird sicher eine Rolle gespielt haben. „Schlachtfeld“ kommt einmal mehr aus der Abteilung abstrus. Ein Profikiller sieht sich mit lebendig gewordenen und äußerst schießwütigen Spielzeugsoldaten konfrontiert. Erneut ein Beweis dafür, dass selbst eine völlig hanebüchene Ausgangssituation von einem King immer noch in ein spannendes und äußerst unterhaltsames Erlebnis umgeschmiedet werden kann.
Nach den Spielzeugsoldaten folgen nun die „Lastwagen“, welche gleich mehrere Menschen in einer Raststätte umzingelt haben und mit röhrenden Motoren darauf warten, die Fliehenden über den Haufen zu fahren. Bekloppt, oder? Mag sein, aber wieder für den Leser ein riesiger und bis zum (bitteren) Schluss äußerst mitreißender Spaß. Noch besser – und meines Erachtens eine der gelungensten Geschichten der Sammlung – ist „Manchmal kommen sie wieder“, in der ein High-School-Lehrer, der als Kind seinen Bruder an vier mörderische Jugendliche verloren hat, sich in der eigenen Klasse mit deren haargenauen Abbildern konfrontiert sieht. Und wieder beginnen die Morde und er muss sich den Albträumen seiner Vergangenheit stellen. Eine ganz starke Erzählung! Das gilt auch für „Erdbeerfrühling“, in der ein Serienmörder alle 7 bis 8 Jahre brutale Morde an der Universität begeht. Ein kurzer, aber äußerst gruseliger Horror-Trip, an dessen Ende eine gewisse Agatha Christie vielleicht ihre Freude gehabt hätte.
Freunde des „Hardboiled“ und „Noir“ dürften wiederum bei „Der Mauervorsprung“ bestens unterhalten werden, das vollkommen ohne übersinnliche Elemente auskommt. Das Gefahrenelement – ein nur wenige Zentimeter breiter Vorsprung im 43. Stockwerk eines Hochhauses. Die Art Lektüre, bei der man das Buch unwillkürlich fester packt – um es dann bei „Der Rasenmähermann“ am liebsten an die Seite zu legen. Selbst für King-Verhältnisse war mir dieses benzingetränkte Gebrumme dann doch eine Spur zu albern und zu grotesk. Ja, auch hier gibt es einen verborgenen Subplot, den man mit etwas Aufmerksamkeit entdecken kann. Das ändert aber nichts daran, das mir diese Geschichte nicht wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist. Ganz anders verhält es sich dann wieder mit „Quitters, Inc.“, welche insbesondere den Rauchern unter den Lesern ans Herz gelegt sei. Ob die danach noch zur Zigarette greifen werden, darf aber immerhin bezweifelt werden. Grandiose Geschichte!
Bei „Ich weiß, was du brauchst“ vermischt King Voodoo mit einem Schuss Romantik – oder ist es doch andersherum – kann mich dabei aber nicht überzeugen. Voll in seinen Fängen hat er mich dann dafür wieder in „Kinder des Mais“, an dessen Verfilmung sich vielleicht mal N. Night Shyamalan versuchen sollte, der sich im Aufbau einer sich immer mehr anspannenden Atmosphäre ja trefflich auskennt. Diese atemlose, gehetzte Flucht durch scheinbar undurchdringliche Maisfelder wird mir jedenfalls noch lange in Erinnerung bleiben. Hier ist man wirklich traurig, das es so schnell vorbei ist.
Jede Sekunde und Zeile auskosten sollte man bei der Lektüre von „Die letzte Sprosse“, in der Stephen King seine meines Erachtens – mit großem Abstand – beste Leistung in der ganzen Sammlung abliefert. All diejenigen, die ihn immer, wider besseren Wissens, als Unterhaltungsautor müde belächeln, sollten sie lesen, um zu erkennen, welch begnadeter, aber auch einfühlsamer Schriftsteller er in Wirklichkeit ist. Ein trauriges, melancholisches, tief berührendes Juwel, nach dessen Beendigung es automatisch einer längeren Pause braucht, um die nächsten Geschichten in Angriff zu nehmen. Diese sind alle ebenfalls von guter bis sehr guter Qualität.
„Zu einen auf den Weg“ habe ich mich ebenfalls schon bei „Brennen muss Salem“ geäußert. In „Der Mann, der Blumen liebte“ wird der Leser geschickt auf die falsche Fährte geführt. Und in „Die Frau im Zimmer“ verarbeitete Stephen King den Tod seiner eigenen Mutter und setzt sich zugleich mit dem Thema Sterbehilfe auseinander.
Wenn man so nach oben hochscrollt, erscheinen mir das ziemlich viele Worte für eine schon so alte Kurzgeschichten-Sammlung, welche die meisten King-Fans wohl ohnehin schon kennen werden und die jüngeren vielleicht gar nicht mehr lesen mögen. Letzteres wäre aber, und soviel sollte hoffentlich deutlich geworden sein, ein Fehler, denn bereits in diesen frühen Erzählungen läuft der Meister des Horror, trotz ein paar Durchhängern, zur Höchstform auf. Sein Talent für die Kurzform, es hat diese Würdigung und eine Wiederentdeckung sicher verdient.
Wertung: 87 von 100 Treffern
- Autor: Stephen King
- Titel: Nachtschicht
- Originaltitel: Night Shift
- Übersetzer: verschiedene
- Verlag: Lübbe
- Erschienen: 10.2010
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 448 Seiten
- ISBN: 978-3404131600