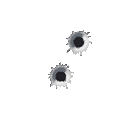„Sein letzter Trumpf“ ist der siebte, beim Zsolnay-Verlag erschienene Roman aus der Reihe um den leidenschaftslosen und eisenharten Berufsverbrecher Parker. Eine Figur, die für ein paar Jahre trotz (oder gerade wegen) seiner kriminellen Ader zu einem festen Bestandteil der deutschen Krimi-Szene geworden war – nur um mittlerweile leider wieder in der Versenkung zu verschwinden.
Ihr Schöpfer, der amerikanische Schriftsteller Donald E. Westlake, welcher die Parker-Bücher unter dem Pseudonym „Richard Stark“ veröffentlichte, weilt bereits seit dem Silvesterabend 2008 nicht mehr unter den Lebenden. Seit diesem Jahr versorgte Zsolnay die Leser hierzulande im chronologischen Rückwärtsgang mit neuen Episoden. „Sein letzter Trumpf“ wurde im amerikanischen Original bereits 1998 publiziert und von Stephen King als Einstieg in die Lektüre Richard Starks empfohlen. In diesem Fall ein gutgemeinter Rat, den man tatsächlich beherzigen sollte, ist doch dieser Titel nicht nur ohne jegliche Vorkenntnisse lesbar (anders als bei „Fragen sie den Papagei“ oder „Das Geld war schmutzig“), sondern gleichzeitig auch einer der besten aus Starks späterer Schaffensperiode.
Der letzte Raubüberfall ist, wenn auch mit personellen Verlusten, gerade über die Bühne gegangen, da lockt Parker bereits die Aussicht auf einen neuen Coup: Ein Casinoschiff, das den Hudson befährt und in drei Wochen den Betrieb aufnimmt, soll ausgeraubt werden. Keine einfache Aufgabe, da man unbemerkt Waffen an Bord bringen und irgendwann mit der Beute wieder runter vom Schiff muss. Parkers Auftraggeber, ein lokaler Politiker im Ruhestand, der bisher erfolglos gegen die Legalisierung des Glücksspiels gekämpft hat, will zwar brauchbare Pläne und alle sonstigen Details liefern, sich sonst jedoch komplett heraushalten. Das bedeutet mehr Profit, aber auch mehr Arbeit. Arbeit, die Parker alleine nicht leisten kann. Deshalb stellt er ein schlagkräftiges Team aus zuverlässigen Leuten zusammen: Dan Wycza, den Mann fürs Grobe. Mike Carlow, den Fahrer. Lou Sternberg, der einen arroganten Abgeordneten auf Kontrollbesuch mimen wird. Und Noelle Braselle, welche, im Rollstuhl mit installierter Bettpfanne sitzend, mit dem Geld das Schiff verlassen soll. Als es schließlich soweit ist, klappt anfangs alles wie am Schnürchen. Doch jeder Plan hat seine Schwachstellen. Und als eine Bikergruppe von ihrem Coup Wind bekommt und ein korrupter Polizist sich an seine Fersen heftet, muss Parker wieder mal zur Waffe greifen …
Richard Stark spielt auf seine Klaviatur auch in „Sein letzter Trumpf“ wieder mal explizit eine unterbewusste Schwäche der Krimileser an: Die Sympathie für den Bösewicht. Obwohl Parker, der raubt, lügt, betrügt und mordet, sich selbst wohl kaum als Böse bezeichnen würde, ist er doch nach allen Paragraphen des Gesetzes eigentlich zu verurteilen. Ein Mensch, dessen Bekanntschaft man eigentlich nicht machen, in dessen Visier man nicht geraten will. Und doch ertappt sich der Leser dabei ihn zu mögen. Er drückt die Daumen, hofft das der Plan gelingt, am Ende alles gut ausgeht. Wobei er eigentlich weiß, dass „gut“ in diesem Fall bedeutet: Der Verbrecher entkommt mit der Beute. Das dem letztlich immer so ist, weiß der Parker-Leser schon bevor er das Buch überhaupt aufgeklappt hat. Aber wieso sollte man es dann denn überhaupt lesen? Wie kann ein Roman, dessen Ausgang man bereits kennt, spannend sein?
Nun, hierin liegt die große Stärke von Richard Stark, dem mit Parker eine Figur gelungen ist, die einem, trotz ihrer zweifellos äußerst dunklen Seiten, Respekt und Bewunderung abnötigt. Dieser amoralische Held plant mit sparsam-kühler Effizienz, wartet geduldig, kennt keine Nervosität und räumt Hindernisse eiskalt aus dem Weg. Die Möglichkeit, das etwas schief geht, kalkuliert er von vornherein mit ein, weshalb ihn Rückschläge nicht aus der Bahn werfen. Kurzum: Parker ist ein Profi. Und als ein solcher kann man sich weder amourösen Verbindungen noch Freundschaften hingeben. So ist auch diesmal die Arbeit im Team dem Job geschuldet. Parker braucht die Hilfe seiner Kumpanen, um den Raub durchzuziehen. Es geht ums Geld. Und nur ums Geld. Für weitere moralische Verpflichtungen ist da kein Platz. Und weil sich das herumgesprochen hat, ist Parker inzwischen ein gefragter und auch bei anderen Verbrechern beliebter Mann. Er ist verlässlich, sein Wort gilt, seine Pläne versprechen Profit. Was natürlich nicht heißt, dass er immer Erfolg hat oder niemand versucht ihn übers Ohr zu hauen. Wenn Letzteres passiert, schlägt Parker gnadenlos zurück. Nie übertrieben brutal, aber meist zumindest so drastisch, dass jeder die Botschaft kapiert: Lege dich nie mit Parker an.
Mit dieser Kaltschnäuzigkeit, dieser bedingungslosen Zielgenauigkeit nimmt Stark den Leser früh für Parker ein, der dessen Planungen und Vorbereitungen verfolgt und gebannt beobachtet wie die Rädchen nach und nach ineinander greifen. Gleichzeitig wird die Geschichte um Handlungsstränge erweitert, die außerhalb der Kontrolle des eiskalten Berufskriminellen liegen. So droht unter anderem ein verdeckt recherchierender Journalist auf dem Casinoschiff die Tarnung auffliegen zu lassen, während ein skrupelloser Cop in aller Ruhe eine Falle aufbaut, welche bei Parkers Rückkehr vom erfolgreichen Beutezug zuschnappen soll. Diese und andere sich im weiteren Verlauf auftürmende Hindernisse gilt es aus dem Weg zu räumen. Und sie sind es auch, die aus einem simplen, problemlosen Raubüberfall eine höchst brenzlige und lebensgefährliche Angelegenheit machen, welche zur Improvisation zwingt und damit immer wieder für Spannung sorgt.
Und die kommt hier wahrlich nicht zu kurz. Auch weil Richard Starks sachliche und direkte Schreibe dem Leser jegliche langatmige Ausschweifungen erspart und kein einziges Wort zu viel verschwendet. Wo andere Krimiautoren heutzutage noch den kleinsten Manschettenknopf en detail beschreiben und Auskunft über die Verwandtschaftsgrade der Familie eines Ermittlers geben, da belässt es Stark bei dem, was der Handlung dienlich ist. Keine Schwenks, Kurven oder Kehren. Nur ein Gaspedal, das mit jeder weiteren Seite tiefer durchgetreten wird. Diese Geradlinigkeit und völlige Abstinenz überflüssigen Geschwätzes ist genauso Kennzeichen der Reihe, wie die Zurückhaltung des Autors bei der Zeichnung seiner Hauptfigur. Egal was alles im Laufe eines Coups passiert: Am Ende weiß man über Parker genauso viel wie am Anfang. Er bleibt ein Mann ohne Identität. Ein Mann, dessen Gedanken und Gefühle genauso im Verborgenen bleiben, wie sein nie genannter Vorname.
„Sein letzter Trumpf“ hat neben all diesen üblichen Ingredienzien allerdings noch weit mehr zu bieten, da Stark sich diesmal auch in Punkto Setting ein paar zusätzliche Sternchen verdienen kann. Ob auf dem beleuchteten Casinoschiff in tiefer Nacht oder im triefenden Dreck einer Gaststättentoilette. Die Handlungsorte bieten Kopfkino vom Feinsten, machen Parkers Treiben noch zusätzlich lebendiger, der diesmal in allen Belangen zur Höchstform aufläuft. Wenn Parker mit gezücktem Colt Python im Dunklen an Häuserwänden vorbeischleicht oder einfach nur wortlos sein Gegenüber niederstarrt, hält man unwillkürlich den Atem an. Ein diabolisches und wissendes Grinsen im Gesicht. Bis zur letzten Silbe.
Der achtzehnte Parker ist atemberaubende und zuspitzende Spannung auf 283 Seiten, die mal so wirklich jeden Cent wahrlich wert sind und welche man am Ende nur äußerst ungern aus der Hand legt. Es bleibt zu hoffen, dass derart kompromisslose und gradlinige Kriminalliteratur auch weiterhin den Weg auf den deutschen Buchmarkt finden wird. Angesichts solcher Qualität sollte weiterhin auch die Neuauflage älterer Bände in Erwägung gezogen werden.
Wertung: 94 von 100 Treffern
- Autor: Richard Stark
- Titel: Sein letzter Trumpf
- Originaltitel: Backflash
- Übersetzer: Rudolf Hermstein
- Verlag: Zsolnay
- Erschienen: 02.2011
- Einband: Broschiertes Taschenbuch
- Seiten: 283 Seiten
- ISBN: 978-3552055360