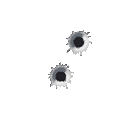© Rowohlt
„Ich kenne keinen Schriftsteller, der nicht glaubt, dass er ein Boxer ist.“
Bei dieser auf den eitlen Norman Mailer gemünzten Aussage Nelson Algrens mag er auch ein bisschen an sich selbst gedacht haben, war doch der in Chicago aufgewachsene Autor Zeit seines Lebens ein fanatischer Fan dieser rauen Sportart. Die Innenseite seines rechten Oberarms zierten als Tätowierung ein paar Boxhandschuhe. Sein Lieblingsschauspieler war Charles Bronson, nicht zuletzt weil er kein Antlitz hatte, sondern ein Gesicht. Und zwar das eines Boxers. Selbst im Arbeitszimmer seiner Wohnung in Hackensack, New Jersey, hing neben dem Porträt Dostojewskis ein Foto von Rubin „Hurricane“ Carter. Man kann daher schon von einer gewissen Zwangsläufigkeit sprechen, sieht man sich die Entstehungsgeschichte seines biographischen Romans „Calhoun“ etwas näher an.
1983, zwei Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht, erzählt Nelson Algren in „Calhoun“ die Geschichte des berühmten Boxers Rubin Carter, genannt „Hurricane“, der 1966 wegen Mordes inhaftiert und erst 1985 nach mehrfacher Wiederaufnahme des Verfahrens freigelassen wurde. Ein Fall, der nicht nur aufgrund von Bob Dylans Song und der Verfilmung mit Denzel Washington als Carter bis heute noch in den Köpfen der Boxfreunde präsent ist, sondern auch für viele Jahre die Debatte um den Rassismus in der US-amerikanischen Justiz stark befeuert hat. Algren greift diese Thematik in seinem Roman auf, verflechtet das Boxmilieu mit der etwas anderen Arena Gerichtssaal und zeichnet ein düsteres Bild vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das bis heute wohl nicht allzu viel an Aktualität verloren hat. Umso interessanter, dass Algren ursprünglich gar keinen Roman im Sinn hatte. Als Carter und sein Freund John Artis, beide Afroamerikaner, in New Jersey des Mordes an drei Weißen für schuldig befunden und für dreimal lebenslänglich ins Gefängnis geschickt wurden, war der Autor als Reporter des „Esquire Magazine“ lediglich damit beauftragt, einen Artikel mit Interview zu machen. Doch es sollte anders kommen.
Algren, der den Schuldspruch aufgrund fragwürdiger Zeugenaussagen zweier Kriminelle vor einer durchweg weißen Jury von Beginn an für einen Skandal hielt, rechnete zumindest zu Beginn im Falle eines Wiederaufnahmeverfahrens mit einem Freispruch. Erst als dieser ausblieb bzw. das erste Urteil bestätigt wurde, sah sich Algren in der Pflicht, auf diesen Justizirrtum und vor allem die Logik dieses Irrtums aufmerksam zu machen. Da man dies den Lesern des „Esquire Magazine“, welche kaum den Bürgerrechtlern angehörten, nicht zumuten konnte, schrieb er die ursprüngliche Story um. Aus einem einfachen Artikel wurde ein dokumentarischer Prozessbericht und schließlich, mangels Interesse anderer Zeitungen, ein Roman, den der Autor, der vorerst weiter am Tatort (eine kleine Stadt namens Paterson) blieb und sogar nach New Jersey zog, stetig mit Informationen aus weiteren Recherchen anreicherte. Für Algren war „Calhoun“ dabei die ganze Zeit mehr als nur die Geschichte eines Boxers – es war seine letzte Abrechnung mit einem Amerika, eine Anklage gegen die andauernde rassistische Gewalttätigkeit weißer Geschworenengerichte und deren stille Billigung durch eine große Bandbreite der Bevölkerung.
Wie schon in seinem bekanntesten Roman „Der Mann mit dem goldenen Arm“, so singt auch hier „die Blechpfeife der amerikanischen Literatur“ (Algren über sich selbst) noch ein letztes Mal das Hohelied auf den Scheiternden, den Einzelgänger in den Höllen der so genannten „Freiheit.“ Aus heutiger Sicht liest sich dies immer noch kraftvoll, allerdings auch mit viel Bitternis und Pathos durchsetzt, denn Algren, der stets den Verlierer der Gesellschaft überzeugend spielte, aber nie wirklich verkörperte, bezieht in einigen Passagen zu eindeutig Position, was der Dramatik der Geschichte zwar entgegen kommt, dem ein oder anderen Justizbeamten im Nachhinein jedoch vielleicht nicht ganz gerecht wird. Dem eindringlichen Charakter von „Calhoun“ tut dies jedoch keinerlei Abbruch. Lange vor einem Scott Turow oder John Grisham wird hier die Widersprüchlichkeit des amerikanischen Justizsystems genauso in seine Einzelteile zerlegt, wie die verhängnisvolle Einflussnahme der wohlmeinenden Prominenz (u.a. Bob Dylan) auf Carters Wiederaufnahmeverfahren.
Um es in der Boxsprache zusammenzufassen: „Calhoun“ geht über die volle Distanz von 12 Runden und leistet uns, den Lesern, einen harten Kampf, da Algren immer wieder zwischen den Zeiten springt und auch die vielen Spitznamen der kriminellen Unterwelt New Jerseys oftmals zur Verwirrung beitragen.
„Calhoun“ ist eine eindringliche, rasiermesserscharfe Wiedergabe über die Umstände des Falls Rubin „Hurricane“ Carter, an der man sich immer wieder schneiden und reiben kann. Eine eckige, kantige, nicht immer leichte Lektüre, wie sie typisch für Algren war. Ob man das mag oder nicht – Geschmackssache. In seine Fußstapfen ist bis heute jedenfalls nicht wirklich nochmal jemand getreten. Das dürfte dem „Verlierer“ Algren aber gefallen haben, der einer angehenden Schriftstellerin, welche auf der Schwelle zu einer literarischen Karriere stand, per Brief einmal folgenden Rat mitgab:
„Geh zwei Schritte zurück, Baby. Lauf davon, lauf, so schnell du kannst. Das ist keine Schwelle – das ist ein Abgrund.“
Wertung: 80 von 100 Treffern
- Autor: Nelson Algren
- Titel: Calhoun – Roman eines Verbrechens
- Originaltitel: The Devil’s Stocking
- Übersetzer: Carl Weissner
- Verlag: Rowohlt
- Erschienen: 1/1999
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 305 Seiten
- ISBN: 978-3499136825