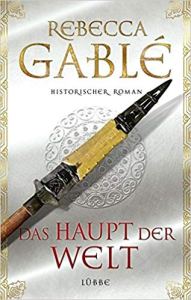Knapp vier Jahre nach dem Auftakt zur Reihe um Otto, den Großen lässt Rebecca Gablé mit „Die fremde Königin“ eine Fortsetzung folgen, die ungefähr dreizehn Jahre nach „Das Haupt der Welt“ ansetzt und den Leser damit zurück in eine Epoche führt, in welcher der ostfränkische König und Herzog von Sachsen sein Herrschaftsgebiet auf Italien auszudehnen versucht. Ein, wie wir aus heutiger Sicht wissen, entscheidender Zeitraum in seiner Regentschaft und damit beste Voraussetzung für einen weiteren großen historischen Roman aus der Feder der deutschen Bestseller-Autorin. Doch wird Gablé diesen Erwartungen diesmal auch gerecht?
Fakt ist: „Das Haupt der Welt“ war einmal mehr eine durchgehend kurzweilige und gewissenhaft recherchierte Lektüre, ließ aber das gewisse Etwas, diesen speziellen, ansteckenden Funken ihrer vergangenen Werke über weite Strecken vermissen und überraschte stattdessen durch für Gablé untypische, unnötig ausgewalzte und en detail beschriebene Romanzen, was ihr meiner Ansicht nach nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal geraubt, sondern auch den qualitativen Abstand zur Genre üblichen, femininen Schmuse-Literatur verringert hat. Hinzu kam mit Tugomir leider noch ein farbloser Protagonist, der keiner der Figuren aus ihrer Waringham-Saga auch nur ansatzweise das Wasser reichen und mit dem man sich entsprechend wenig identifizieren konnte. So überwiegt vor Beginn der Fortsetzung also tatsächlich die Skepsis. Und diese ist, so viel darf ich vorab verraten, letztendlich dann auch nicht ganz unberechtigt.
Garda, Norditalien 951 n. Chr. Nach dem Tod ihres Gemahls Lothar, dem ehemals mächtigsten Mann der Lombardei, darbt dessen Witwe Adelheid im Turmverlies der mächtigen Burg, unter Druck gesetzt vom unbarmherzigen Markgraf Berengar von Ivrea, der es auf ihre rechtmäßige Krone abgesehen hat und sie zu diesem Zweck mit seinem Sohn vermählen will. Die Chancen sich ihm zu widersetzen schwinden mit jedem weiteren Tag, denn Berengar schreckt auch nicht davor zurück, das Leben ihrer Tochter Emma zu bedrohen. Sie beschließt die Initiative zu übernehmen und findet tatsächlich einen Ausweg aus ihrem Gefängnis, durch den ihr letztlich sogar die Flucht gelingt. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Auch König Otto I. ist aus ganz persönlichen Gründen an ihrer Rettung gelegen und hat einen seiner besten Panzerreiter, den jungen Bastard Gaidemar ausgesandt, um sie zu befreien. Gemeinsam entkommen sie knapp ihren Häschern und erreichen die Burg von Canossa, von wo mit Graf Atto einer der wenigen Verbündeten des Königs in Italien regiert. Während Otto in Adelheid vor allem die Eintrittskarte für Italien sieht, hat Gaidemar weit tiefere Gefühle für die leidenschaftliche Frau, was diese schließlich dennoch nicht davon abhält, den charismatischen Herzog von Sachsen zu heiraten.
Daheim an dessen Hof in Magdeburg hat Adelheid nicht nur aufgrund der kalten Temperaturen so ihre Anpassungsprobleme, kann aber dennoch nach und nach das Volk für sich gewinnen. Sehr zum Missfallen von Ottos Sohn Liudolf, der die mangelnde Unterstützung seines Vaters beklagt und mit steigender Wut beobachtet, wie ihm sein Onkel, Herzog Heinrich von Bayern, immer wieder vorgezogen wird – ungeachtet dessen vieler Verfehlungen in der Vergangenheit. Während Gaidemar nach und nach in den Rängen der Panzerreiter aufsteigt und als „Schatten der Königin“ für deren Schutz sorgt, rumort es zunehmend mehr unter den Adligen des Reichs. Als es zum Aufstand kommt muss sich Gaidemar zwischen seiner Freundschaft zu Liudolf und der Loyalität zur Königin entscheiden. Doch ein weit größere Gefahr setzt den Konflikten in Ottos Herrschaftsgebiet ein jähes Ende: In Bayern und Schwaben sind die Ungarn eingefallen. Und anders als in der Vergangenheit machen sie diesmal keinerlei Anstalten, sich wieder zurückzuziehen. Otto sieht sich gezwungen, die Heere mehrerer Länder unter seiner Führung zu vereinen, um dem Feind die Stirn bieten zu können. Auf dem Lechfeld nahe Augsburg kommt es für alle schließlich zur Schlacht, welche das Schicksal der deutschen Herzogtümer – und damit der Deutschen an sich – entscheiden soll …
Vielleicht kann man es schon Beginn zwischen den Zeilen herauslesen, aber diese Rezension wollte irgendwie nicht so flüssig zu „Papier gebracht“ werden, wie ich das gewohnt bin, da ich mich äußerst schwer damit getan habe, die einzelnen positiven und negativen Aspekte mit Augenmaß zu gewichten. So darf ich zwar nachdrücklich konstatieren, dass sich Gablé mit „Die fremde Königin“ gegenüber dem Vorgänger wieder verbessert hat, zuletzt auffällige Schwächen sich aber auch durch diesen Roman ziehen. Ja, wenn man die nostalgische Verklärung außen vor lässt, so waren auch die frühen Werke der Autorin in ihrer Charakterisierung immer etwas modern geraten und nie wirklich dem mittelalterlichen Setting verpflichtet. Dennoch waren es gerade die historischen Figuren und ihre Zeichnung, welche die Barrieren der Geschichte bei der Lektüre so schnell zu Fall brachten und dafür gesorgt haben, dass man sich nach wenigen Seiten widerstandslos der geistigen Zeitreise hingab. Diesen Widerstand zu überwinden, gelang Gablé zuletzt leider seltener und hier macht sie auch beim vorliegenden Titel nur kleine Fortschritte, denn mit Ausnahme von Liudolf sind mir nach Beendigung des Buches keine weiteren der realen Persönlichkeiten in Erinnerung geblieben. Das ist insofern hervorzuheben, da es gerade ein William, der Eroberer oder ein John of Gaunt war, der mit seiner Präsenz die Helmsby bzw. Waringham-Titel getragen und nachhaltig beeindruckt hat. Überhaupt gibt es meines Erachtens einfach zu wenig Otto in diesem historischen Epos über eben jenen Herrscher. Und wenn er die Bühne mal für sich beanspruchen kann, wird er uns als naiver, unsicherer und extrem wankelmütiger König präsentiert, den die Power-Frau Adelheid nach Belieben zu lenken weiß.
Während Gablé hier also wenig Fortschritte macht, ist ihr dafür mit der Hauptfigur, dem Bastard Gaidemar wieder ein echter Volltreffer gelungen. Der harsche, verschlossene und unerbittliche Panzerreiter ist nicht nur eine Söldnerseele nach meinem Geschmack, sondern auch mit hoher Wahrscheinlichkeit – an den historischen Gegebenheit gemessen – am ehesten akkurat gezeichnet und wartet zusätzlich mit einer interessanten Hintergrundgeschichte auf, die sich nur nach und nach entblättert. In vielen seiner Charakterzüge erinnert er (nicht grundlos) an Ottos Bruder Thankmar aus „Das Haupt der Welt“ und sorgt mit seiner schroffen Natur für die dringend benötigte Reibung in diesem über weite Strecken äußerst „bequemen“ Roman. Und mit bequem beziehe ich mich auf die Situation in der sich die Protagonisten größtenteils befinden, denn es fehlt einfach an Dramatik und an Gefahrenpotenzial – und vor allem an einem hinreichend ernst zunehmenden Antagonisten, um überhaupt so etwas ähnliches wie ein Gefühl der Sorge beim Leser zu wecken. Ob auf der Schlacht auf dem Lechfeld – welche Gablé übrigens fantastisch in Szene gesetzt hat, ein Highlight dieses Buches – oder beim Aufstand und dem mysteriösen Tod Liudolfs (den die Autorin ruhig größer in die Handlung hätte einbauen können), es will sich kein richtiges Spannungsmoment aufbauen, das zumindest zwischenzeitlich mal Zweifel am Erfolg der Beteiligten nährt. Gerade hier hat Gablé in der Vergangenheit ihre Stärken gezeigt und uns selbst um Charaktere bangen lassen, deren historischen Lebenslauf man ja eigentlich bereits kennt.
So negativ der Tenor nun insgesamt klingen mag, „Die fremde Königin“ ist einmal mehr ein lesenswertes Buch. Rebecca Gablé erweckt diesen Zeitabschnitt der frühen deutschen Geschichte farbenfroh und atmosphärisch zum Leben, kann die mitunter komplizierten Familienverhältnisse und politischen Bündnisse erfrischend kurzweilig übermitteln und vermag Ottos Weg zur Kaiserkrone dank ihrer profunden Kenntnis akkurat zu Papier bringen. Dieser Weg ist allerdings weit linearer als ich mir das gewünscht hätte und – ja, ich muss sie nochmal lobend erwähnen – von ihren frühen Waringham-Romanen gewohnt bin. Mehr Komplexität, mehr Mut zur Tiefe und weniger massentaugliche Zugänglichkeit hätten diesem zweiten Band des Zyklus sicher gut zu Gesicht gestanden.
Wertung: 87 von 100 Treffern
- Autor: Rebecca Gablé
- Titel: Die fremde Königin
- Originaltitel: –
- Übersetzer: –
- Verlag: Bastei Lübbe (Ehrenwirth Verlag)
- Erschienen: 04.2017
- Einband: Hardcover
- Seiten: 768
- ISBN: 978-3431039771