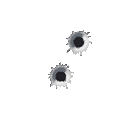Als Ende der 2000er Jahre der Fischer Verlag in Kooperation mit der Website „Krimi-Couch“ im Rahmen der Reihe „Fischer Crime Classics“ die Wiederveröffentlichung einiger klassischer Kriminalromane ankündigte, war die Vorfreude unter vielen Usern im damals noch recht lebendigen Forum entsprechend groß. Nicht nur waren einige der dort eingeplanten Autoren hierzulande seit langem vergriffen – auch an das Konzept einer inhaltlich verbundenen Serie hatten sich die Verlagshäuser seit der DuMont-Kriminalbibliothek kaum noch herangewagt. Eine Renaissance des Whodunits, sei sie auch nur so klein, hatte sich daher durchaus ein kleiner Teil der Leserklientel erhofft. Allein, diese Hoffnungen wurden enttäuscht, was rückblickend unterschiedliche Gründe gehabt haben dürfte.
In erster Linie war dies wohl der mangelnde (oder anders bzw. optimistischer kalkulierte?) Absatz der Titel, welcher der „Fischer Crime Classics“-Reihe nach bereits zwei kurzen Staffeln ein jähes Ende bescherte und nicht nur einem begrenzten Käuferkreis, sondern auch der Zusammenstellung und der austauschbaren, vollkommen einfallslosen Cover- und Buchrückengestaltung geschuldet war. Sticht beim fleißigen Sammler ein Titel von Pulp Master, aus Rotbuchs „Hard Case Crime“-Reihe oder aus eben der bereits genannten DuMont-Kriminalbibliothek schon im Regal heraus, gestaltet sich bei den Fischer-Büchern dieser Serie eine Suche in der hauseigenen Bibliothek eher schwierig.
Lieblos war ein Adjektiv, das daher im Zusammenhang mit diesen Neuauflagen – alle gedruckten Werke waren in Deutschland bereits schon einmal veröffentlicht worden – häufiger fiel. Meines Erachtens zurecht, denn mehr als zehn Jahre später sind die „Fischer Crime Classics“ auch dadurch vollkommen in Vergessenheit geraten – und damit leider gleichzeitig ein paar Spannungsromane, welche für Kenner der Geschichte des Kriminalromans (oder solche die es werden wollen) sicherlich von Interesse sein dürften. Nicht zuletzt auch wegen dem stets sehr ausführlichen und vor allem kenntnisreichen Nachwort von Lars Schafft, dem ehemaligen Betreiber der Krimi-Couch.
Dies ist im Fall des vorliegenden Titels wieder äußerst lesenswert, arbeitet es doch den besonderen Stellenwert von Edmund Clerihew Bentleys „Trent’s letzter Fall“ auf eine Art und Weise heraus, welche eigentlich eine zusätzliche Besprechung weitestgehend überflüssig macht. Da aber gerade dieser Titel für die Entwicklung des Genres von enormer Bedeutung ist, sei dennoch dieser Versuch gewagt, wobei ich mit einer kurzem Anriss der Handlung beginnen möchte:
England, Anfang der 1910er Jahre. Der freie Journalist, Künstler und Amateur-Detektiv Philip Trent wird von seinem Chefredakteur Sir James Molloy kontaktiert, welcher einen neuen Auftrag für ihn hat. Sigsbee Manderson, Multimillionär, Geschäftstycoon und Börsenspekulant, wurde tot im Obstgarten vor seinem Landhaus „White Gables“ aufgefunden. Weil die Wall Street tobt und Scotland Yard bei seinen Ermittlungen komplett im Dunkeln tappt, soll Trent seine Unterstützung anbieten. Diese wird in Person des alten Bekannten Inspector Murch sehr gerne angenommen, der den Privatschnüffler nicht nur einen Blick auf die Leiche gewährt, sondern ihn auch das Haus und den Rest des Grundstücks untersuchen sowie alle Beteiligten verhören lässt. Neben den Toten sind das unter anderem Mandersons Frau Mabel, seine beiden Sekretäre Calvin Bunner (Amerikaner und allein schon deswegen verdächtig) und John Marlowe, den Diener Martin und das Dienstmädchen Célestine. Nathaniel Cupples, ein weiterer alter Freund von Trent und angeheirateter Onkel, weilt zur selben Zeit noch in einem Hotel im Nachbardorf.
Nach und nach wird Trent immer mehr in den Fall hineingezogen, der sich nicht nur als schwierigster seiner Karriere herausstellen soll, sondern auch einige Überraschungen für ihn bereithält. So findet er bald heraus, dass die Eheleute alles andere als in Harmonie gelebt haben und sieht sich irgendwann auch von der Witwe mehr und mehr angezogen. Doch welches Spiel spielt sie wirklich? Und wer ist nun eigentlich der Mörder?
Bereits im Jahr 1941 titulierte der Autor Howard Haycraft den ersten Band der Reihe, der ironischerweise aber „Trent’s letzter Fall“ heißt, als „Eckpfeiler der Detektivgeschichte“ – und in der Tat stellt dieses Werk den Beginn einer neuen Ära da, die wir heute auch als „Golden Age“ des Kriminalromans bezeichnen. Zwar ebnet Bentleys Buch als Inbegriff des Cosys, des beschaulichen Landhauskrimis, vor allem einer Vielzahl bekannter Autoren wie Agatha Christie, Dorothy L. Sayers und John Dickson Carr den Weg – dennoch war es dem Autor vor allem wichtig seinen Detektiv nicht zwingend als kalten, rein logischen und damit auch künstlichen Übermenschen zu zeichnen – und sich damit natürlich auch so weit wie möglich von Doyles großem Sherlock Holmes zu entfernen, der zuvor den Kriminalroman wie kaum ein anderer – vor allem in Großbritannien – geprägt hat.
Trent versteht sich somit als Gegenentwurf zu dem Pfeife rauchenden Meisterdetektiv aus der Baker Street, was Bentley auch deutlich herausarbeitet. So ist der Privatschnüffler hier ein äußerst umgänglicher, ja, freundlicher und empathischer Zeitgenosse, dessen Vorliebe für Kriminalistik eher spielerischer Natur ist und somit beim Leser weit weniger intellektuell ausgerichtetes, aber weiterhin anspruchsvolles Miträtseln voraussetzt. Damit soll sich direkt zu Beginn ein heimeliges Wohlbehagen einstellen – eine willkommene Ablenkung vom Alltag, der sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Romans im Jahr 1913 zusehends unter den Schatten des drohenden kriegerischen Konflikts der damaligen Weltmächte verdüsterte. Eine Entwicklung, welche Bentley genauso konsequent ausblendet, wie jeglichen Schwermut, so dass sich „Trent’s letzter Fall“ vor allem wie ein kurzweiliges Kammerstück liest, ein literarisch abgebildetes, fast spielerisches Ringen zwischen Mörder und der Detektiv, welche natürlich immer Gentleman bleiben. Ohne es zu wissen, hatte er damit die Blaupause des Whodunit geschrieben, welcher vor allem in Großbritannien das Genre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs weitestgehend dominieren sollte. Das „Golden Age“ der Detektivgeschichte – es war angebrochen.
Hierzulande ist Bentleys Name nur noch Krimi-Kennern geläufig, was insofern wenig verwundert, da sein Roman zwar eine neue Richtung eingeschlagen, aber in Punkto Spannung wenig neue Maßstäbe gesetzt hat. „Trent’s letzter Fall“ liest sich gefällig, bietet entschleunigende Kurzweil für den Sonntagnachmittag auf dem Sofa, kommt jedoch besonders zu Beginn nur ziemlich behäbig in Gang. Wem diese klassische, britische Gemütlichkeit liegt, wird an der altertümlichen, doch schönen Übersetzung bestimmt Gefallen finden und sich vor allem an Bentleys Talent zu Beschreibungen erfreuen können. Insbesondere seine stimmungsvollen Darstellungen des Landhauses bleiben in Erinnerung und projizieren ein gutes Bild vom Tatort. Dem ein oder anderen wird dabei vielleicht auffallen, dass der Autor mit Zitaten nicht geizt. Warum er dies tut, wird im Nachwort nochmal näher erläutert, das auch weitere tiefe Einblicke in die Gedankenwelt Bentleys gewährt. Dieser wiederum widmete sein Werk Gilbert Keith Chesterton, dem er übrigens 1936 als Präsident des elitären und bekannten Detection Clubs nachfolgte. Ihm folgte dreizehn Jahre später Dorothy L. Sayers, welche „Trent’s letzter Fall“ zu ihren Lieblingsromanen und wichtigsten Inspirationen zählte.
Doch zurück zum Krimi selbst und damit dem wichtigsten Punkt: Die Auflösung. Interessanterweise bricht Bentley für diese mit einigen der späteren (nicht immer streng ausgelegten; siehe „Alibi“) Regeln des Detection Clubs, denn er legt nicht alle Indizien offen, welche eigentlich benötigt werden, um als Leser selbst den Fall zu knacken. Er spielt schlicht unfair, was allerdings dem Plot geschuldet ist, der knapp in der Mitte eine Wendung erfährt, mit der so wohl die wenigsten gerechnet haben. Zumindest wenn sie meinem Rat folgen, nicht zuvor den Klappentext zu lesen, der ärgerlicherweise viel zu viel verrät. Ein weiterer Wermutstropfen ist zudem die tatsächlich unheimlich ätzende Liebesgeschichte, die einem irgendwann genauso auf den Keks geht, wie Trents mitunter affektiertes Gehabe.
Was bleibt am Schluss: Immer noch ein durchaus lesenswerter, früher Vertreter des klassischen Detektivromans, den alle Freunde des „Golden Age“ uneingeschränkt genießen dürften – und mit Adleraugen betrachten sollten, legt er doch das Fundament, auf dem Jahre später Agatha Christie und Co. ihre Erfolge bauen werden.
Wertung: 80 von 100 Treffern
- Autor: Edmund Clerihew Bentley
- Titel: Trent’s letzter Fall
- Originaltitel: Trent’s Last Case
- Übersetzer: Monika Elwenspoek
- Verlag: Fischer
- Erschienen: 02/2009
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 288 Seiten
- ISBN: 978-3596182473