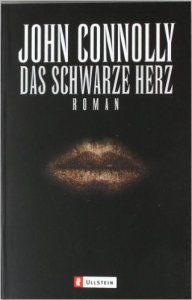© Goldmann
Nostalgie ist eine schöne Sache, aber sie verklärt bekannterweise oft den Blick auf die Wirklichkeit und zeichnet ein Bild, dass es so nur in unserer eigenen Erinnerung gegeben hat. Insofern war ich nun einigermaßen neugierig, als ich Nick Stones Debütwerk „Voodoo“ ein zweites Mal zur Hand nahm, mehr als zehn Jahre nach der ersten Lektüre. In einer Zeit, in der das Forum der Internetseite Krimi-Couch noch ein äußerst belebter Ort und Treffpunkt vieler gleichgesinnter Krimi-Freunde war, welche sich nicht nur über ihr aktuellstes Buch austauschen konnten, sondern auch gegenseitig den eigenen Literaturhorizont erweiterten.
Es war hier, wo einem der Facettenreichtum dieses Genres gewahr wurde und man über das Lesen hinaus tiefer in eine Materie eintauchte, die inzwischen zumindest aus meinem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Und es war auch hier, wo zwischen Ende 2007 und Anfang 2008 eben jener Roman in aller Munde war und allseits – und damit auch von mir – gepriesen wurde. So viele Jahre danach stellt sich jetzt Frage: Waren diese hymnischen Rezensionen tatsächlich gerechtfertigt oder hatte ich mich damals in meinem jugendlichen Eifer auch ein bisschen beeinflussen lassen?
Letzteres lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, hätte doch sonst allein schon die optische Aufmachung genügt, um Stones Roman zu meiden. Sowohl das Cover als auch der reißerische Titel ließen bzw. lassen hier auf ein Werk im Stil eines Jean-Christophe Grangé schließen, das eher in der blutrünstigen Ecke des Kriminalromans beheimatet ist und zudem noch Mystery- und Okkult-Elemente in den Mittelpunkt stellt. Eine Annahme, die nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte, erheblich in die Irre führt und einmal mehr die Unfähigkeit gewisser Verlage deutlich macht, ein Buch auch passend zum Inhalt zwischen dem Einband zu vermarkten. Und spätestens ein Jahrzehnt später lässt sich tatsächlich konstatieren: Nick Stone und sein Roman „Voodoo“ hätten nicht nur eine weitaus bessere Werbung verdient gehabt, sondern sicher auch gebrauchen können, ist doch vielen Freunden des hochklassigen Hardboiled hier ein äußerst empfehlenswerter und vor allem durchaus realistischer Vertreter des Subgenres durch die Lappen gegangen.
Eine Neubetrachtung lohnt also, umso mehr, da Autor Nick Stone, dessen Mutter selbst aus Haiti, dem Schauplatz des Buches stammt, nicht nur erstklassig recherchiert, sondern auch gleichzeitig eine Milieustudie eines der ärmsten Länder der Welt vorgelegt hat und damit der westlichen Welt, und ihrer Kultur des Wegschauens, den Spiegel vorhält. Stone hat tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, will weit mehr als nur unterhalten und schafft doch auch dies von Seite eins an.
Diese nimmt ihren Anfang im Jahr 1996. Max Mingus, Ex-Cop und ehemaliger Privatdetektiv aus Miami, steht kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Sieben lange Jahre hat er seine Haft abgesessen, als Strafe dafür, einst im kalten Zorn drei Männer erschossen zu haben, die einer brutalen und mörderischen Kidnapper-Bande angehörten. Eine Tat, die zwar die Unschuldigen gerächt, Mingus selbst aber nichts als Unglück gebracht hat. Seine Frau kam bei einem Autounfall ums Leben, seine eigene Detektei musste dicht machen und seine ehemaligen Kollegen – bis auf seinen langjährigen Partner und Freund Joe Liston – wollen von ihm nichts mehr wissen. Die Welt, wie er sie kannte, sie liegt in Trümmern. Als die Gefängnistore sich hinter ihm schließen, liegt lediglich das Nichts vor ihm. Doch ein Mann scheint eine Aufgabe für ihn zu haben: der Milliardär Allain Carver.
Bereits während seiner Zeit im Gefängnis wurde Mingus immer wieder von ihm kontaktiert und darum gebeten, einen heiklen Auftrag anzunehmen. Mingus lehnte stets ab. Bis jetzt, bis er hört, welche Summe ihm für die Erledigung des Jobs angeboten wird. Zehn Millionen Dollar winken ihm als Belohnung, wenn ihm gelingt, woran bereits mehrere Detektive vor ihm – äußerst schmerzvoll – gescheitert sind: Charlie Carver zurück seiner Familie zu bringen. Allain Carvers Sohn wurde vor zwei Jahren auf Haiti entführt. Es gab nie ein Lebenszeichen und auch keinerlei Lösegeldforderung. Mingus‘ Vorgänger kehrten brutal misshandelt oder erst gar nicht zurück – es scheint, als würde irgendjemand nicht wollen, dass Carver gefunden wird. Doch was bedeutet wirklich Gefahr für jemanden, der ohnehin alles verloren hat. Und der in dem vielen Geld seine Chance sieht, nochmal neu zu beginnen.
Schon bei seiner Ankunft in der Ofenhitze von Haiti muss er erkennen, dass er von echtem Verlust zuvor keine Ahnung hatte. Das Land liegt wirtschaftlich am Boden, die Menschen sind bitterarm und von einer politischen Stabilität kann keinerlei Rede sein. Vielmehr befindet sich die Karibikinsel im Ausnahmezustand. Ein Zustand, an dem auch Präsident Jean-Bertrand Aristide seinen Anteil hat, der aufgrund seiner amerikafreundlichen Haltung kurzerhand von den USA ins Amt gehievt wurde, welche seitdem Haiti mit Truppen besetzt halten, um dessen Macht zu sichern. Hinzu kommen diverse UN-Verbände verschiedenster Nationen, die ihrer eigentlichen Aufgabe, der Friedenssicherung, schon lange nicht mehr nachkommen. Entsprechend herzlich fällt auch der Empfang für Max Mingus aus, dem zwar die Mittel der mächtigen Carver-Familie zur Verfügung stehen, welche aber außerhalb von Port-au-Prince nur von geringer Hilfe sind. Stattdessen haben Warlords das Kommando, allen voran der gefürchtete Vincent Paul, der beschuldigt wird, hinter Charlie Carvers Entführung zu stecken. Doch handelt es sich bei ihm tatsächlich um „Tonton Clarinette“, den Schwarzen Mann, welcher der Legende nach des Nachts die Kinderseelen raubt?
Max Mingus Ermittlungen lassen ihn bald an den Intentionen aller Beteiligten zweifeln. Und als er von seinem Partner die Nachricht erhält, dass sein Todfeind Solomon Boukman – ein skrupelloser Mann und selbsternannter Voodoo-Priester, der ihm einst Rache schwor – begnadigt und zurück in seine Heimat abgeschoben wurde, ahnt er, dass selbst zehn Millionen für diesen Auftrag noch zu wenig sein könnten …
Man könnte es sich einfach machen und „Voodoo“ einfach als einen Private-Eye vor exotischer Kulisse abstempeln, in dem einmal mehr ein gebrochener, vom Leben gezeichneter Anti-Held das Leid dieser Welt schultert und – umgeben von karibischen Schönheiten – der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft. Ja, und genau all das ist Nick Stones Erstlingswerk eben nicht, denn wenngleich er sich tatsächlich bekannter Elemente des klassischen Noirs bedient, so liegt doch der eigentliche Kriminalfall nur an der Oberfläche. Und wir als Leser brechen diese nach und nach auf, um zu sehen was darunter liegt, denn Stone weiß nicht nur wovon er schreibt, er hat auch eine fühlbar emotionale Bindung zu diesem Land, was besonders deutlich wird, wenn er die gnadenlosen Auswüchse des Kapitalismus skizziert und die Amerikaner mit ihrem kolonialistischen Treiben konfrontiert. Wohlgemerkt ohne dabei an irgendeiner Stelle zu moralisieren. Stattdessen lässt er den Ami sich selbst offenbaren, was angesichts des aktuellen Treibens eines Donald Trump rückblickend umso glaubwürdiger erscheint.
Überhaupt versteht es Stone vorzüglich mit unseren Erwartungen und Annahmen zu spielen, in falsche Richtungen zu leiten und Brotkrumen zu verteilen, welche uns letztlich in eine Sackgasse führen. Und obwohl dies mehr als einmal geschieht, stellt sich keinerlei Langeweile ein, was wiederum daran liegt, dass sich der Autor als äußerst geschickt erweist, wenn es darum geht, aus dem Weg das Ziel zu machen. Neben Max Mingus ist hier allen voran Haiti der zentrale Protagonist – und diese Insel wird mit allen ihren Sonnen- und Schattenseiten zum Leben erweckt. Fernab der touristischen Hochglanzbroschüren öffnet sich uns ein Land, welches zwischen dem modernen Aufschwung und traditionellen Bräuchen gefangen ist, seinen eigenen Weg ins das 21. Jahrhundert sucht und doch dabei immer wieder von außerhalb an der Hand genommen, besser gesagt gepackt wird. Wie Nick Stone diese Ausbeutung verdeutlicht ist mir besonders anhand einer Szene bis heute in Erinnerung geblieben. In dieser wird eine Gruppe indischer UN-Soldaten von Vincent Paul mit den von ihnen begangenen Übergriffen auf haitianische Frauen konfrontiert. Mangels irgendeiner Gerichtsbarkeit, spricht Paul auch gleich direkt das Urteil, das noch an Ort und Stelle vollstreckt wird. Hut ab vor all den Lesern, welche sich an dieser „Stelle“ nicht im Lesesessel ihres Vertrauens winden.
Übrigens ist dies einer der wenigen Ausbrüche von Brutalität, welche sich dieser Roman erlaubt, der ansonsten auf ganz andere Art und Weise für Entsetzen sorgt. Wenn sich nach und nach die wahren Hintergründe von Charlie Carvers Verschwinden offenbaren, das ganze Ausmaß klar wird, erweitert sich nicht nur unsere Perspektive – wir beginnen auch diesen tiefen, verzweifelten und doch auch machtlosen Zorn der Haitianer zu verstehen, die, um ihr Überleben kämpfend, der Willkür ihrer Herrscher – sei es von innen oder von außen – nichts mehr entgegenzusetzen haben. Im Angesicht dieses Elends und dieser Ungerechtigkeit gelingt Stone das Kunststück Bodenhaftung zu bewahren, denn anstatt sich als den Tag rettender Held zu entpuppen, muss der zynische Max Mingus weitestgehend die Kontrolle über das Geschehen abgeben und zur Seite treten. Er muss einsehen, dass diese haitianische Angelegenheit letzten Endes auch nur von Haitianern geregelt werden kann. Und inmitten dieser emotionalen Offenbarung kredenzt uns der Autor dann auch noch eine Wendung, die wohl selbst gut beobachtende Leser nur in den wenigsten Fällen voraussehen konnten. Chapeau für diesen Schlag aus dem Nichts, Mr. Stone.
Was bleibt nun nach der Lektüre – und mehr als zehn Jahre nach dem Erstkontakt? Das Denkmal „Voodoo“ hat zwar in der Tat über die Zeit ein wenig gebröckelt und Macken bekommen – die Überzeugung, hier einen einzigartigen und lohnenswerten Kriminalroman gelesen zu haben, konnte aber auch im zweiten Durchgang nicht erschüttert werden. Ein immersives, eindringliches und düsteres Noir-Werk, das sich schwer abschütteln und seine Spuren hinterlässt. So darf, so muss heutzutage ein Krimi sein.
Wertung: 89 von 100 Treffern
- Autor: Nick Stone
- Titel: Voodoo
- Originaltitel: Mr. Clarinet
- Übersetzer: Heike Steffen
- Verlag: Goldmann Verlag
- Erschienen: 11/2007
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 608 Seiten
- ISBN: 978-3442463367