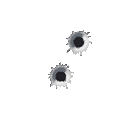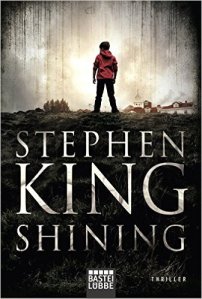
© Bastei Lübbe
Im Vergleich Verfilmung mit literarischer Vorlage zieht erstere in der allgemeinen Auffassung in den meisten Fällen der Kürzeren. Und doch gibt es immer wieder Fälle, in welcher die Popularität der Leinwandversion das Buch längst überholt hat. Stephen Kings „Shining“ ist hierfür ein mehr als treffendes Beispiel.
Fast unmöglich allein den Titel zu lesen, ohne an Jack Nicholsons furchteinflößendes Spiel und sein manisch-irres Grinsen zwischen den Resten der zertrümmerten Badezimmertür zu denken. Ein Moment in der Geschichte des Kinos, der inzwischen Kult ist, und das obwohl Autor King, dessen Roman im Jahre 1977 als dritter nach „Carrie“ und „Brennen muss Salem“ (und drei Jahre nach seiner Fertigstellung) veröffentlicht wurde, an Stanley Kubricks Interpretation bis heute kein gutes Haar lässt. Gerade in Nicholson sieht er eine fatale Fehlbesetzung. Und wahr ist: Legt man Kings Werk neben das Drehbuch, fallen dem aufmerksamen Beobachter eklatante Unterschiede ins Auge. Kubrick hat wenig von der Essenz des Buches übernommen und vollkommen andere Schwerpunkte gesetzt. So fällt die Vorgeschichte von Jack Torrance, sein Scheitern als Lehrer und damit der Grund für seine Anstellung im „Overlook“-Hotel, fast gänzlich weg. Auch dessen Alkoholsucht wird zwar angedeutet, hat aber im Gegensatz zum Roman keinerlei Zusammenhang mit dem ihm befallenden schleichenden Wahnsinn.
Stephen King hat schließlich Mitte der 90er, frei nach dem Motto „Am besten macht man alles selbst“, eine vierteilige Serie für das Fernsehen folgen lassen. Unter seiner Leitung entstanden, hält sie sich, auch was den Umfang angeht (über 270 Minuten Länge), eng ans Buch. Trotz guter Kritiken blieb der Erfolg der Neuverfilmung hinter Kubricks Version zurück, was der Ausnahmestellung von „Shining“ im Gesamtwerk Kings jedoch keinerlei Abbruch getan hat. Das scheint auch der „König des Horror“ schon vor einiger Zeit selbst erkannt zu haben. Lange angekündigt, erschien mit „Doktor Sleep“ Ende 2013 eine direkte Fortsetzung, deren Handlung drei Jahre später einsetzt. Nur ein Grund mehr, sich diesen Klassiker des psychologischen Horrors noch einmal zu Gemüte zu führen.
Seinen Anfang nimmt „Shining“ in den schroffen Bergen von Colorado. Hier thront seit Anfang des Jahrhunderts einsam das legendäre Hotel „Overlook“. Im Sommer Treffpunkt der amerikanischen High-Society, wird es im tiefen Winter, durch meterhohen Schnee von der Außenwelt getrennt, nur vom Hausmeister und seiner Familie bewohnt. Auf eben diese Stelle bewirbt sich Jack Torrance. Ein ehemaliger Lehrer, selbsternannter Intellektueller und Hobby-Literat, für den der Job im „Overlook“ die scheinbar letzte Möglichkeit darstellt, wieder finanziell auf die Beine zu kommen und die brüchige Beziehung zu Frau Wendy und Sohn Danny zu kitten. Zudem sieht er in der winterlichen Abgeschiedenheit der Umgebung beste Voraussetzungen, den lang gehegten Traum vom eigenen Theaterstück endlich auf Papier zu bringen. Allen Warnungen zum Trotz – der letzte Hausmeister Delbert Grady brachte im Hotel seine gesamte Familie um und richtete sich anschließend selbst – und entgegen den Wünschen des Direktors, der gern einen Single für die Stelle gehabt hätte, tritt Torrance samt Familie in den letzten Tages des Herbstes seine Arbeit im „Overlook“ an.
Anfänglich scheinen alle Träume der Familie in Erfüllung gehen. Während Jack sein langjähriges Alkoholproblem immer weiter hinter sich lässt und auch in der Ehe mit Wendy einen zweiten Frühling erlebt, freut sich der fünfjährige Danny über das wiedergewonnene Glück seiner Eltern. Doch im Besitz des Zweiten Gesichts, des „Shining“, sieht der Junge Bilder aus Zukunft und Vergangenheit, welche die Idylle trügerisch und hohl erscheinen lassen. Gewarnt vom Chefkoch des Hotels, dem Schwarzen Dick Hallorann, der seine Gabe teilt, meidet er gleich mehrere Bereiche des „Overlook“. Aber der Ort selbst scheint Mittel und Wege zu finden, auf Danny und seine Familie Einfluss zu nehmen. Fahrstühle bewegen sich des Nachts plötzlich höllisch laut ratternd durch die Etagen. Die Heckentiere im großen Vorgarten verändern ihre Position. Und obwohl der Direktor versichert hat, dass alle Gäste abgereist sind, werden sie das Gefühl nicht los, dass sie nicht allein sind. Wer oder was befindet sich in Zimmer 217?
Nach und nach enthüllen sich die grauenhaften Ereignisse aus der langen Geschichte des „Overlook“, welches zusehends die Kontrolle über Jacks Geist gewinnt. Getrieben von dessen bösen Willen treibt er schleichend in den Wahnsinn. Und für Wendy und Danny beginnt in den langen Korridoren des vom Schnee eingeschlossenen Hotels ein Kampf ums Überleben …
Ein abgelegener, vom Rest der Welt abgeschnittener Ort in den Bergen. Ein einsames Hotel voll riesiger langer Korridore. Ein alter, knarrender Fahrstuhl. Von Schneestürmen umtoste Fensterläden. „Shining“ weist all die Rahmenbedingungen auf, mit denen schon vierzig Jahre zuvor John Dickson Carr seine „Locked-Room“-Mystery erzählte. King nimmt diesen Faden mit der Situation der Torrance-Familie nicht nur auf, sondern führt hier auch konsequent seine eigenen Stilelemente weiter. War in „Carrie“ das Geburtshaus der titelgebenden Protagonistin „nur“ Schauplatz der grausamen fanatisch-religiösen Erziehung ihrer Mutter, wurde das Marsten-Haus in „Brennen muss Salem“ bereits zur Manifestation des Bösen, aus dem der Vampir Barlow seinen Feldzug gegen die Stadt Jerusalem’s Lot führte. In „Shining“ geht King nun nochmal eine Stufe weiter, fungiert das „Overlook“ als Handlungsort UND Hauptfigur. Aus dem menschlichen bzw. menschenähnlichen und damit greifbaren Grauen wird ein, für die Protagonisten wie Leser gleichermaßen, nicht fassbarer Gegenspieler (Allein Danny ist es möglich, sich der versuchten Einflussnahme des Hotels zumindest teilweise zu entziehen). An dieser Stelle setzt auch die Kritik Kings an Kubricks Interpretation an, der Jack Torrance nicht nur von Anfang an als verrückt und verschroben zeigt, sondern diesem zugleich die Hauptrolle übertragen hat.
Jack Torrance ist aber nicht nur Zankapfel zwischen Verfilmung und Buch, King bezeichnet dessen Charakterisierung auch als letztlich ausschlaggebend für seine weitere Karriere als Schriftsteller. Nach „Carrie“ und „Brennen muss Salem“ von Kritikern und Lesern dem Horrorgenre zugeordnet, wurde „Shining“ zum von ihm selbst bezeichneten Wendepunktroman („a crossroads novel“), mit dem er die vorgegebenen Pfade der in erster Linie auf Unterhaltung ausgerichteten Literaturkategorie verlässt. Hier findet sich der Ursprung für die so oft angeprangerte Weitschweifigkeit Kings, der in seinen Figuren nicht nur ein Mittel sieht, um den roten Faden durch das Handlungsgebäude zu weben, sondern stets deren Mehrdimensionalität betonen will. Vom schlichten Held will er genauso wenig wissen wie vom tumben Bösewicht. Stattdessen begegnet uns mit der Familie Torrance drei Menschen mit Problemen, wie sie in fast jedem Haushalt vorkommen und die, und das ist besonders wichtig hinsichtlich der Zeichnung von Jack, auch Stephen King selbst alles andere als unbekannt sind.
Der erfolglose Lehrer, welcher allein die wirtschaftliche Existenz der Familie schultern muss und nach und nach dem Alkohol verfällt – das hat eindeutig autobiographische Züge. Und das King mit der Situation vertraut war, liest und spürt man auch immer wieder zwischen den Zeilen. Überhaupt ist die Darstellung der Figuren, neben den unheimlich intensiven und beklemmenden Beschreibungen des „Overlook“, ein Highlight des Romans. Entgegen dem „Overacting“ Nicholsons vollzieht sich das Abgleiten in den Wahnsinn von Kings Jack langsam und schleichend. Misshandelt von seinem eigenen Vater und von einer nie verarbeiteten Hassliebe geprägt, hat sein Fall im Buch weit tragischere Züge (Um das ganze Ausmaß zu begreifen, empfiehlt sich hier übrigens die Lektüre der bisher unübersetzten Kurzgeschichte „Before the play“). Die Übergriffe auf seinen Sohn, der unterdrückte Zorn, welchen der Leser bereits zu Beginn während dem Vorstellungsgespräch bemerkt – all das unterstreicht die Hoffnungslosigkeit von Jack Torrance‘ Lage. Egal, was er anpackt oder sich vornimmt geht schief. Seine von vorneherein feststehende Niederlage ist die Konsequenz seines Handelns, mit der er unbewusst selbst erlebte Kindheitserinnerungen verarbeitet. Das „Overlook“ spiegelt letztlich diese dunklen Flecken der Familie, gibt den lange unterdrückten Aggressionen ein Ventil und versucht sie für eigene Zwecke zu nutzen. Wie der Heizkessel, dessen Druck Jack in seiner Tätigkeit als Hausmeister stets zu kontrollieren hat, so nimmt auch das Buch mit jeder Seite mehr der gespannten Atmosphäre auf, bis sich Wut und Hass in einem blutigen und äußerst dramatischen Finale entladen.
Das verfolgt der Leser erschöpft, ernüchtert, traurig und am Ende auch etwas erleichtert. Völlig zerschlagen von dieser Gratwanderung zwischen Familientragödie und Horror-Roman, die, ganz in der Tradition eines „Psycho“ von Robert Bloch, auf kleinstem Raum und im Sekundentakt für Gänsehautmomente sorgt.
Mit „Shining“ ringt Stephen King einem als trivial verschrieenen Genre nicht nur neue Facetten ab – er beweist auch nachdrücklich, dass er sich in seiner erzählerischen Kraft nicht hinter den großen Namen der US-amerikanischen Literatur zu verstecken braucht. Ein beklemmendes, packendes Meisterstück, das bis heute kein bisschen von seiner Wirkung verloren hat.
Wertung: 93 von 100 Treffern
- Autor: Stephen King
- Titel: Shining
- Originaltitel: The Shining
- Übersetzer: Harro Christensen
- Verlag: Bastei Lübbe
- Erschienen: 04.1985 (21. Auflage)
- Einband: Taschenbuch
- Seiten: 624 Seiten
- ISBN: 978-3404130085