
© Kunstmann
Als großer Fan von „The Wire“ und den Werken von Richard Price war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis David Simons „Homicide“ auf meinem Nachttisch landen würde, dessen True-Crime-Werk in gewissem Sinne die Blaupause für obige Serie (und die gleichnamige TV-Verfilmung „Homicide“) darstellt. Nun habe ich es bereits zum zweiten Mal gelesen. Warum? Tja, vor allem deshalb weil es mir nach der ersten Lektüre unheimlich schwer fiel, meine Gedanken in Worte zu fassen und „auf Papier zu bringen“, was auch daran lag, dass ich zum damaligen Zeitpunkt immer nur sporadisch einige Seiten verschlingen konnte und dementsprechend ziemlich lange für das Buch brauchte. Diesmal nahm ich mir die Zeit und kann nur konstatieren – richtige Entscheidung. Meine Eindrücke zu „Homicide“ nun hier:
„In den letzten fünfzehn Jahren hat sich unsere Arbeit in mancher Hinsicht verändert. Der sogenannte CSI-Effekt, also die Auswirkung der Darstellung der Ermittlungsarbeit in Krimis und Serien auf das öffentliche Bild von der Polizeiarbeit, hat die Erwartungen von Geschworenen und Richtern in unzumutbare Höhen getrieben und ist überall zum Fluch der Staatsanwälte geworden. Die Einschüchterung von Zeugen hat zugenommen, und die Kooperationsbereitschaft der Bürger ist zurückgegangen, was nicht überrascht. Gangs haben Baltimore für sich entdeckt. Das Drogenproblem ist keineswegs geringer geworden. Es gibt weniger Dunker (der einfache, offensichtliche und schnell zu lösende Mordfall) und mehr Whodunits (das genaue Gegenteil davon). (…) Doch unterm Strich sind solche Veränderungen von geringer Bedeutung, und die Arbeit eines Detectives ist im Großen und Ganzen immer noch genau so, wie David Simon sie geschildert hat. Sie ist bestimmt von Tatorten, Befragungen und Verhören vor dem Hintergrund menschlicher Schwächen. Und so wird es immer sein.“
So die das Buch abschließenden Worte von Terrence „Terry“ McLarney, Lieutenant des Baltimorer Morddezernats, nur einem der vielen Protagonisten in David Simons True-Crime-Werk „Homicide – Ein Jahr auf mörderischen Straßen“, dessen Veröffentlichung in Deutschland fast genau zwei Jahrzehnte (und meiner Ansicht nach damit viel zu lange!) auf sich warten ließ. Eins davon hat inzwischen auch McLarneys Schlusswort auf dem Buckel und dennoch sei es dieser Besprechung vorangestellt, fasst es doch die Entwicklung der Ostküsten-Metropole nicht nur treffend zusammen, sondern auch den „ewigen Kreislauf der Scheiße“ (Richard Price, „Clockers“), in dem sich zwar die beruflichen Begleitumstände und Bedingungen im Wandel der Zeit geändert haben, die Arbeit für den Mordermittler aber immer noch dieselbe geblieben ist. Und sie ist es, welche Simon – aus dessen Buch nicht nur die gleichnamige Serie „Homicide“ (1993-1999) entstand, sondern der auch verantwortlich für die Realisierung solcher TV-Schwergewichte wie „The Wire“ oder „Treme“ zeichnet – in seiner literarischen Reportage in den Vordergrund stellen wollte.
Im Jahr 1988 begann Simon mit seinem Projekt. Von Januar bis Dezember schloss er sich – sonst Reporter bei der „Baltimore Sun“ – den Polizisten der Mordkommission (Homicide) aus Baltimore unter der Leitung von Detective Lieutenant Gary D’Addario an, begleitete sie bei ihren Einsätzen und Ermittlungen, lauschte an der Tür zum Verhörraum, notierte ihre Gespräche, trank mit ihnen und nahm gar an einer Autopsie mit anschließendem Mittagessen teil – wurde damit also zu einem „Embedded Journalist“, wie man ihn sonst eher aus Kriegsgebieten kennt. Das war Baltimore zu diesem Zeitpunkt zwar nicht – sechs Jahre früher hielt der so genannte „Barksdale Krieg“ (thematisch aufgegriffen in „The Wire“) die Stadt in Atem – die Mordrate inzwischen aber weiterhin kontinuierlich gestiegen und am 31. Dezember 1988 sollte die weiße Tafel im Versammlungsraum der Homicide Section 234 Morde verzeichnen. (Nur zum Vergleich: 2015 wurden 344 gezählt. Und das obwohl die Bevölkerung seit den frühen 90er Jahren über 100.000 Einwohner verloren hat) Schon diese Zahl verdeutlicht, was der Job eines Detectives in erster Linie ist – tagtägliche Fließbandarbeit, die wenig bis nichts mit dem Bild der Polizei gemein hat, was viele TV-Krimiserien und Filme uns in der Regel verkaufen wollen. Ein unrealistisches Bild, das, so lernen wir hier, inzwischen auch das amerikanische Justizsystem bedroht, da es dadurch immer schwieriger wird, Geschworene zu bekommen, die für ihre Aufgabe tatsächlich geeignet sind bzw. verstehen, dass es eben nicht möglich ist, jeden vor Gericht gebrachten Fall mittels DNA-Analyse, Fingerabdrücken, Mordwaffe, Motiv und Zeugen abzusichern.
Nicht selten scheitern genau deshalb Anklagen, was umso härter trifft, als der Leser über 800 Seiten erfahren muss, mit welcher Härte und Hingabe die Ermittler ihre Aufgabe nachgehen, wohl wissend, dass die Mühe durchaus umsonst sein kann. Die Realität – sie ist hart, sie ist ernüchternd und sie ist weit schmerzhafter als es jegliche Fiktion sein könnte. Und sie verändert diejenigen, welche sich jeden Tag damit konfrontiert sehen. Ein guter Detective – das wird man nicht innerhalb kurzer Zeit und schon gar nicht hinter dem Schreibtisch. Das muss in „Homicide“ vor allem Tom Pellegrini erfahren, der gleich zu Beginn seiner Karriere bei der Mordkommission mit einem so genannten „Red-Ball“ konfrontiert wird – einem Tötungsdelikt, dem höchste Aufmerksamkeit gilt. In diesem Fall ist dies Latonya Wallace. Ein elfjähriges Mädchen, auf dem Weg von der Bibliothek nach Hause brutal umgebracht und in einem schäbigen Hinterhof im Stadtteil Reservoir Hill abgelegt. Selbst für die abgebrühten und abgestumpften Ermittler ist dies ein Mord, der längst verloren geglaubte Gefühle weckt. Und für David Simon auch das perfekte Beispiel anhand dem er das Auf und Ab dieses Berufs, das Arbeitspensum, die Gleichgültigkeit der Zeugen und in vielen Phasen auch die Hilflosigkeit des Justizsystems dokumentiert.
Während andere Ermittler, wie der alte Donald „Big Man“ Worden sich mit einer Schusswaffenbeteiligung eines Polizisten herumschlagen müssen oder Rich Garvey mit einer unverschämten Glückssträhne zehn Fälle hintereinander löst, quält sich Pellegrini, anfangs noch von einer Vielzahl von Personal unterstützt, irgendwann komplett allein durch die Akten. Sichtet Beweise neu, untersucht den vermeintlichen Tatort und die Umgebung ein drittes und ein viertes Mal. Wartet auf Laborauswertungen. Und ruft immer wieder den „Fish Man“ aufs Revier – einen älteren Bewohner aus der Nachbarschaft, der bereits in den 50ern wegen eines Sexualdelikts angeklagt worden und bekannt dafür ist, einen Blick auf junge Mädchen zu werfen. Er ist Pellegrinis Hauptverdächtiger. Doch wie ihn überführen?
David Simons Reportage ist fernab von Glanz und Gloria und auch weit davon entfernt, ein Loblied auf den guten, aufrechten Cop zu singen. Stattdessen lässt er uns einen Blick auf eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen und Charakteren werden, die verschiedene Talente aufweisen, mal mehr, mal weniger sympathisch daherkommen. Männer, unterbezahlt, überarbeitet und aufgrund vieler rassistischer und homophober Witze nicht immer wirklich gesellschaftsfähig. Und dennoch deshalb nicht gleich Rassisten oder Schwulenhasser. Es sind Männer, die vollkommen in ihrer Arbeit aufgehen, nur selten ein Ventil für ihren Frust finden, Lob nicht zu erwarten haben und denen in den meisten Fällen selbst von denjenigen, denen sie geholfen haben, Abneigung entgegengebracht wird. Das differenzierte Bild, welches wir dank Simon hier erkennen können, zeigt – vielleicht zum ersten Mal im Genre des „True Crime“ – unverwässert und ohne literarische Ausschmückung, was es heißt, Tag ein, Tag aus, der Arbeit als Detective nachzugehen. Es zeigt die gesundheitlichen und familiären Folgen. Es zeigt, dass Motive in einem Mord weit weniger wichtiger sind, als uns die Rätsel-Krimis weismachen wollen. Und es zeigt, dass Glück und Scheitern in diesem Beruf eng zusammenliegen.
Es gibt drei Säulen jeder Mordermittlung. Spuren. Zeugen. Geständnisse. Und es gibt die zehn goldenen Regeln eines Mordermittlers (in der aufwändig und schön gestalteten Kunstmann-Ausgabe auf dem Lesezeichen aufgedruckt), von denen die letzte vielleicht die wichtigste und am schwersten zu akzeptierende ist:
„Es gibt ihn, den perfekten Mord.“
„Homicide“ – das ist vor allem ein unverdaulicher Brocken. Ein Buch, das sich dem „Page-Turning“ verweigert, das die Aufmerksamkeit des Lesers vollkommen beansprucht und auch dessen seelische Resistenz auf die Probe stellt. Die Nüchternheit, wenn auch immer gepaart mit einen schwarzen, beißenden Humor, sie bestimmt die Szenerie. An einem Spannungsbogen, an künstlerischer Dramatik – an all dem war David Simon nicht gelegen, wodurch die Lektüre Zeit und Geduld einfordert. Und auch das Verstehen, wie kostbar und – vor allem zum damaligen Zeitpunkt – einmalig die Einblick sind, die man uns hier gewährt, was wiederum insofern bemerkenswert ist, da sie nicht immer ein moralisch gutes Licht auf die Mordkommission von Baltimore werfen. Da werden Geständnisse ohne Beisein eines Anwalts ertrickst, Zeugen beeinflusst und – wenn ein gar Kollege zu Schaden kam – auch mal deutlichere Argumente verteilt, um einfach Dampf vom Kessel zu lassen oder jemanden zum Reden zu bringen. Wenngleich an dieser Stelle betont sei: So etwas passiert Simons Erfahrung nach tatsächlich höchst selten. Nicht aufgrund von Zimperlichkeit, sondern vor allem weil es sich bei den meisten Verdächtigen um Drogenhändler und unverbesserliche Kleinkriminelle handelt, für die kein Cop seine Karriere riskiert. „Irgendwann“, so die häufige Einstellung, „werden wir eh ein paar weiße Kreidestriche um deinen Arsch malen.“
Würde ich diesem nachhaltig beeindruckenden und prägenden Werk ein Attribut verleihen müssen, es wäre wohl Ehrlichkeit. David Simon ist der natürlichen Versuchung, sich in dem einen Jahr mit seinen neuen „Kollegen“ zu eng zu verbrüdern, nicht erlegen. Dennoch duldeten und akzeptierten sie ihn an seiner Seite, wohl wissend, dass dabei Dinge ans Licht kommen würden, die ihrer Behörde Schwierigkeiten bereiten konnten. Welche das im einzeln letztlich tatsächlich waren, erläutert Simon in seinem äußerst informativen Nachwort, das nicht nur die Parallelen zwischen dem Niedergang des Journalismus und an Funktion orientierter Polizeistrukturen herausarbeitet, sondern auch gleichzeitig schon eine kleine Brücke zu „The Corner“, Simons zweitem größerem „True-Crime“-Bericht schlägt, den er gemeinsam mit dem Ex-Detective Ed Burns (ehemaliger Partner des eigenwilligen Harry Edgerton, einem weiteren wichtigen Protagonisten von „Homicide“) schrieb und welcher sich auf den Drogenhandel und seine Auswirkungen an einer bestimmten Straßenecke konzentriert. Fans von „The Wire“ (übrigens die beste TV-Produktion, die ich jemals gesehen habe) vermuten richtig, wenn sie hier die Ursprünge der Serie vermuten.
Norman Mailer sagt über Homicide: „Das beste Buch, das je ein amerikanischer Autor über die Ermittler eines Morddezernats geschrieben hat.“
Dem sei an dieser Stelle einfach mal nichts mehr hinzugefügt.
- Autor: David Simon
- Titel: Homicide – Ein Jahr auf mörderischen Straßen
- Originaltitel: Homicide – A year on the killing streets
- Übersetzer: Gabriele Gockel, Barbara Steckhan
- Verlag: Kunstmann
- Erschienen: 08.2011
- Einband: Broschiertes Taschenbuch
- Seiten: 829
- ISBN: 978-3888977237
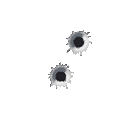
Hervorragende Rezension eines herausragenden Buches. Aber du hast es schon gut beschrieben: Man liest es nicht mal eben so. Ich habe fast vier Wochen gebraucht – sehr untypisch für mich.
LikeGefällt 1 Person
Ging mir ähnlich. Konnte immer nur abends ein paar Seiten lesen. Dementsprechend lang habe ich gebraucht. Aber wie schon erwähnt – selbst wenn man mehr Zeit gehabt hätte, „Homicide“ lässt sich nicht in dem Tempo verschlingen, das ich sonst an den Tag lege. Da geht dann doch zu viel vom Inhalt verloren.
Hast du „The Corner“ auch gelesen?
LikeLike
Und dazu passend:
„Show me a hero“ von Lisa Belkin.
Da bin ich gerade dabei. Ist bei Droemer soeben erschienen. Passt hervorragend zu „Homicide“.
LikeGefällt 1 Person
Oh, hallo Frank. (Kennen uns von der KC, bin da als Stefan83 unterwegs ;-) ) – Zum Thema: Das hab ich bereits auf dem Merkzettel. Genau wie die dazu passende HBO-Serie mit Oscar Isaac. Aber erstmal ist der neue Price dran. Wie gefällt Dir „Show me a hero“ bisher?
LikeLike
Hallo Stefan,
ich bin zwar erst auf Seite 100 (von ca. 450), aber das Buch gefiel mir schon nach den ersten paar Seiten.
Was gefällt mir daran besonders?
Es ist gerade jetzt hier in Deutschland das richtige Buch zur richtigen Zeit. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht von vielen gelesen werden, aber die die es lesen, sehen erschreckende Parallelen zu der jetzigen Situation hier bei uns. Ob nun Häuser deshalb angezündet werden, weil man befürchtet, dass die Verbrechensrate steigt, wenn dort sozialer Wohnungsbau oder Asylunterkünfte gebaut werden, ist egal. Das Ergebnis ist identisch. Und ich vermute dass auch die Ursachen gleich sind und immer gleich sein werden. Es ist ein Gemisch aus Widerstand gegen Veränderungen, Angst zu kurz zu kommen und dem Unwillen Grautöne (Kompromisse) zu akzeptieren (und ggf. zu gestalten).
Beängstigend an dem Buch finde ich, dass die dort beschriebenen Ratssitzungen, in denen mit den Bürgern über die geplanten Wohnungsbauprojekte diskutiert werden sollen, so beschrieben sind, dass sie wie die Blaupause für AFD- oder auch PEGIDA-Versammlungen wirken. Insofern ist das kein neues Phänomen. Das war früher schon da und wird auch immer (ggf. verborgen) vorhanden sein.
Und was ich besonders gut, auch persönlich, nachvollziehen kann ist das Agieren der Person des Nick Wasicsko. So wenig ich auch bisher gelesen habe, so vertrauter erscheint er mir. Er, wahrscheinlich der namensgebende „hero“, ist eine zerrissene Persönlichkeit, die plötzlich in eine Situation geworfen wird und diese aktiv zu gestalten versucht. Er muss das Wohnungsbauprojekt durchziehen und versucht dies durch aktive Gestaltung, obwohl es nicht seiner Meinung entspricht. Aber er weiß, dass er in dieses Amt gewählt wurde, um die Arbeit zu machen und das Beste herauszuholen. Und er kennt das Wort und weiß was es bedeutet, dass seine Gegner (und auch die Leute, die hier bei uns maßgeblich in dieser Richtung hetzen), hassen wie der Teufel das Weihwasser: Sachzwänge! Die gibt es und man muss mit ihnen umgehen und versuchen sie zu gestalten. Und manchmal muss man sie auch hinnehmen.
Ferner ist es für mich immer wieder interessant zu lesen, wie in den USA agiert wird. Das dort vorhandenen Rechts- und Justiz-System hat schon seine Eigenarten, die für uns, na ja, ein wenig komisch wirken, aber aus der Geschichte durchaus erklärbar sind. So wird wahrscheinlich eine Vergabe von Sozialwohnungen bei uns mit einem detaillierten langen Abwägungsprozess wer, warum welche Wohnung bekommt, durchgeführt. Bei diesem Vergabeprozess haben wir das Gefühl dass es gerecht ist, also dem Recht entspricht. Man kann es aber auch anders machen – und zwar so, dass man sagt, dass jeder „Anspruchsinhaber“ das gleiche „Recht“ (oder besser die gleiche Chance) hat – und zwar durch eine Lotterie. Das ist dann schneller als unser Prozess (auch kostengünstiger) und aus Sicht der Leute, die in dem dort allgemein anerkannten System leben, auch „gerechter“.
Das Buch erinnert mich sehr an „Homicide“, das es den „langen“ Weg beschreibt. Die agierenden Personen kämpfen mit realen Begebenheiten (müssen sie ja, das es sich ja um die Realität handelt), wie z. B. der Bürokratie bzw. der vorhandenen Struktur, dem gänzlichen Fehlen von Glück bzw. glücklichen Zufällen und dem nicht immer durchschau- und planbaren Agieren von anderen Personen.
Und am Ende? Bei „normalen“ Krimis ist der Täter gefasst oder tot, die Situation bereinigt. Und hier? Obwohl ich erst auf Seite 100 bin, habe ich das Gefühl, dass dies hier nicht der Fall sein wird. Es wird unbefriedigend enden. Kein Happy-End. Keiner gewinnt – oder die Falschen. Wobei das wohl auch für die Gewinner ein Pyrrhus-Sieg wäre. Aber: That’s life!
LikeGefällt 1 Person
Uff, das könnte glatt als eigenständige Besprechung durchgehen. Danke für die ausführliche Antwort, mit der du mir in jedem Fall ein genaueres Bild vermittelst hast. Das was du da beschreibst, erinnert mich sehr an „The Wire. Die Behördengänge, die finanziellen Widrigkeiten, die politischen Ränkespiele. Damit hatte McNulty genauso zu kämpfen wie der Bürgermeister-Anwärter Carcetti. So etwas hatte ich mir für „Show me a hero“ erhofft. – Wenn man sich draußen umschaut, verwirft man den Gedanken an ein „Happy End“ recht schnell. Die Realität sieht so etwas nicht vor. Dafür sorgt der Mensch, der so gar nichts aus der Geschichte lernen will, ja immer wieder. Und besonders gerade jetzt in Deutschland. – Also vielen Dank für den Einblick! Mal sehen, wann ich dazu komme, es zu lesen. Der SUB ist in den letzten Jahren leider ins Unermessliche gestiegen.
LikeLike
Pingback: By any means necessary | crimealleyblog
Pingback: Been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise … | crimealleyblog